Auch wenn die ersten Plätze dieser Liste sehr mächtig besetzt sind, greift dieser Versuch eines Querschnitts der veröffentlichten Hart- (und Weich-) Metal-Perlen des Jahres letztendlich viel zu kurz. Denn die Masse an hochqualitativen Alben reißt, zum Glück, nicht ab. Das macht zwar die Erstellung der Jahresendliste erheblich schwerer, aber was wäre der Musikenthusiast ohne Luxusprobleme. Daher: Vorhang auf für zwanzig Musikschmankerl des Jahres 2023.
1. Thronehammer – Kingslayer

Pathos und Leidenschaft liegen nah beieinander und sind im Metal gerne und oft hochgehaltene Tugenden. Dieses Jahr schießen Thronehammer mit „Kingslayer“ den Vogel in dieser Kategorie ab. Denn hier fließt das Herzblut in Strömen, tropft in jedem noch so schweren Riff aus den Boxen und dringt in jede Faser des Körpers und Geistes des Hörers ein. Doom Metal-Epen treffen auf schwarzmetallisches Gefühl und zwischendurch hackt das ein- oder andere Death Metal-Growlen die klangliche Schwere auseinander. Dabei klingt das Material durchweg düster, strahlt aber einen kämpferischen Geist aus, der das Albumcover absolut rechtfertigt. Dieses Album zermalmt einen mit einer Intensität, die in Songs wie „Echoes of forgotten Battles“ durchaus auf Bolt Thrower-Niveau agiert. Dass der erwähnte Pathos kein Fremdwort für die Musiker ist, sollte klar sein. Da aber jeder Song unter die Haut geht, ist dieses Drama auch keineswegs zu dick aufgetragen, sondern wird in durchweg mitreißende Hymnen a la „Shieldbreakers“ oder „Mortal Spheres“ gegossen. Besonders letztere stellt sich als vielfältige Nummer zwischen traditionellem Doom Metal und Black Metal heraus, die sich (wie alles an diesem Album) tief ins Herz des Hörers eingräbt. Eine dunkler Walze wie „Triumphant Emperor“ macht dem Cover alle Ehre und erinnert hin und wieder an Celtic Frost, auch weil das Riffing ähnlich minimalistisch ausfällt und dabei doch das Maximum an Theatralik und Energie rausholt. Aber auch filigrane Momente finden sich zuhauf in den Songs. „Halcyon Days of Yore“ etwa ist nicht nur ein Ohrenschmeichler der gewaltigen Art (der Gesang), sondern geht dank akzentuiert filigranem Gitarrenspiel durch Mark und Bein. Und als ob es mit dieser Kampfeshymne noch nicht genug wäre, machen Thronehammer am Ende mit „Ascension“ Tabula Rasa! Wieder gibt’s hypnotische Gitarrenmelodien, diese Stimme, die durch Mark und Bein geht und ein gewisser Hang zur Düsternis, der den kämpferischen Stolz dieses Albums perfekt beschließt. So entpuppt sich „Kingslayer“ am Ende als beeindruckend vielschichtiges Werk, das sowohl in puncto Emotionalität, als auch in Sachen Ausgewogenheit zwischen Genre-Tradition und Variabilität Maßstäbe setzt, wenn nicht für länger, dann doch mindestens für das Jahr 2023!
2. Primordial – How It Ends
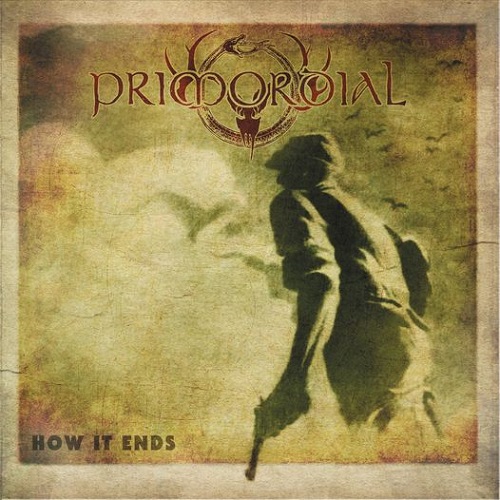
„How It Ends“ beschäftigt sich mit den drastischen Fragen unserer Zeit. Wie endet es? Waren die Zustände der vergangenen Jahre nur ein apokalyptischer Vorbote auf den Abgang der Menschheit? Primordial stellen die Frage nach dem Ende aber auch im Kontext von Staaten und Nationen oder beziehen sich auf Mythen und Traditionen. Das allgegenwärtige Ende wird also aus vielerlei Blickwinkeln betrachtet. Dabei bleiben die Iren erneut ihrem aufrührerischen Charakter treu und liefern eines ihrer ergreifendsten Werke der Neuzeit ab. Dafür verantwortlich ist natürlich Frontmann Alan Averill, der seine Rebellenrolle nicht nur mit cleveren Statements in Interviews breit tritt, sondern selbige durch authentische und ergreifende Musik untermauert. Aber für die emotionalen Furchen, welche die Musik schlägt, sind auch talentierte Instrumentalisten vonnöten. Und als ebensolche schaffen Primordial ein Album voll aufrührerischer Kampfeshymnen. Allen voran das selbsterklärende „We Shall Not Serve“, die weltverdrossenen Schleifer „Nothing New Under The Sun“ und „Death Holy Death“, sowie der schwarzmetallische Stampfer „All Against All“ gehen durch Mark und Bein und spiegeln in gewisser Weise alle Eigenheiten und musikalischen Qualitäten von Primordial wieder. Dabei sind die Iren stets Metal durch und durch, im Kern immer noch aufrührerische Rebellen und haben sich dadurch den Spirit des Heavy Metal (und speziell des Black Metal) auf authentische Art bewahrt.
3. Sorcerer – Reign of the Reaper

Seit nunmehr vier Alben (seit ihrer Reunion) sägen Sorcerer mit einem hochklassigen Silberling nach dem anderen am Heavy Doom-Thron ihrer Landsmänner von Candlemass. „Reign of the Reaper“ ist dabei wohl die vorläufige Meisterleistung der Herren. So schicksalsschwanger, episch und mächtig zelebrieren (abgesehen von der genannten Kapelle und den Erstplatzierten dieser Liste) kaum Genre-Vertreter ihre Doom Metal-Epen. Veredelt von einem genialen Artwork, schichten sich tonnenschwere Riffs, feinste Melodie-Abfahrten und durch Mark und Bein gehender Gesang zu acht musikalischen Volltreffern auf. Dabei vermählen Sorcerer erneut die Theatralik des epischen Doom Metal mit dem Melodieverständnis des klassischen Heavy Metal und erzeugen damit eine Atmosphäre die nicht mal der Schnitter auf dem Cover zu zerschneiden fähig wäre. Hier greift ein Zahnrad perfekt ins nächste und über allem thront Anders Engbergs phänomenaler Gesang. Der Mann durchlebt, durchleidet und exerziert jede Note und vermittelt das Gefühl schicksalhafter Angst, die von der Begegnung mit dem fahlen Reiter herrührt wie nur wenige Genre-Kollegen. Die Kunst dieses Albums ist aber, dass jede Note durch Mark und Bein geht, jede noch so unscheinbare Melodie das ganz große Drama ausstrahlt und die Band zugleich nie ihren Sinn für Dynamik verliert. Daher kann hier auch keine Einzelleistung per se hervorgehoben werden, denn Sorcerer funktionieren als Band, exerzieren ihren epischen Doom Metal mit literweise Herzblut, bleiben dabei aber immer nahbar und erfreulich unkitschig.
4. Royal Thunder – Rebuilding the Mountain

Drogen- und Alkoholentzug, Selbstreflektion und die Wahl zwischen schmerzhafter Katharsis und Lebensmüdigkeit haben „Rebuilding the Mountain“ geformt. Ein Album, das in seiner emotionalen Instabilität die seelischen Zustände seiner Schöpfer reflektiert und damit auf mehreren Ebenen einen Neuanfang markiert. Im Vorfeld zu diesem Album waren Royal Thunder, laut eigener Aussage, knapp davor auseinanderzubrechen. Sowohl als Band, als auch auf persönlicher Ebene der einzelnen Mitglieder. Drogen und Alkohol sei Dank. Wirklicher Dank und Respekt gebührt dagegen dem Kampfgeist der Band, die hier einen Seelenstriptease par excellence abliefert. Irgendwo zwischen den Polen Doom-Rock und klassischem Hardrock begeistert das Trio um Frontfrau Mlny Parsonz mit einem melancholischen Brocken Musik, der zwar vordergründig wenig Raum für fröhliche Klänge lässt, aber doch von einem Kampfgeist zeugt, der nicht nur musikalisch wichtig ist. Dabei ist allem voran Parsonz‘ Stimme dafür verantwortlich, dass die Songs teilweise wie Magenschwinger wirken, obwohl die Musik eher warm-erdig und anheimelnd wirkt. Denn Stücke wie der Opener „Drag Me“ oder der Closer „Dead Star“ sind nicht nur textlich starker Tobak, sondern bringen eine emotionale Zerbrechlichkeit aufs Hardrock-Parkett, die vor allem vom Gesang ausgeht, aber durch die schwermütigen Kompositionen umso eindringlicher wirkt. Die Bandbreite reicht von bedrohlicher Dunkelheit („Now Here/Nowhere“) über Wut („The King“), bis hin zu melodischer Melancholie („Fade“). Dabei eint sämtliche Stücke der Seelenstriptease der Sängerin, wie auch die spürbare Katharsis, welche die Band aus dem Schreibprozess zu diesem Album zog. Dass sich der Hörer hier in einem Wechselbad der Gefühle zwischen Trauer, Stolz, Wut und ähnlichem wiederfindet verwundert daher kaum. Dass letzten Endes der Wille zum Leben, zur Selbstreflektion und zur musikalischen Aufarbeitung der eigenen Seelenthemen überwiegt, macht dieses Album umso eindringlicher!
5. Grave Pleasures – Plagueboys

Kleine Gesten schaffen großes Drama. Oder im Fall von „Plagueboys“ ist es die Selbstsicherheit mit der Grave Pleasures die Abgründe des Menschseins in einen ansteckenden Tanz am Abgrund verwandeln. Egal ob Matt McNerney in Songs wie „When the Shooting‘s Done“ achtziger Jahre-Pop mit Black Metal-Morbidität vermählt, oder ob er Stücke wie „High On Annihilation“ als treibende Gothic-Disco-Nummern präsentiert. Der Musik wohnt stets eine sarkastische Ebene inne, die vom Weltverdruss und der Hoffnung auf bessere Zeiten erzählt und gleichzeitig doch wenig Zuversicht für die Welt suggeriert. Im Zuge dessen überrascht die tränenreiche Ballade „Lead Balloons“ als Hymne, deren Tiefe den Hörer nahezu sofort verschlingt. Allerdings wissen Grave Pleasures immer noch um die tanzbare Qualität von Endzeit-Soundtracks („Society of Spectres“, „Disintegration Girl“) und warten dementsprechend mit Hooks und Melodien en masse auf. Darüber hinaus sind sämtliche Texte auf „Plagueboys“ lesenswert, was dem Album zusätzliche Tiefe verleiht. Grave Pleasures tanzen lachend in den Untergang und liefern eine durch und durch mitreißende Platte ab.
6. Wayfarer – American Gothic

Wildwest-Black Metal, der die Slide-Gitarre zu Blastbeats auspackt? Ja, Wayfarer vertonen auf „American Gothic“ mittlerweile zum fünften Mal die weniger glorreichen Aspekte des Wilden Westens. Dabei ist es in erster Linie die unkonventionelle Herangehensweise mit der Wayfarer ein überaus spannendes Genre-Kleinod eingetütet haben. Wobei sich die Frage stellt, was Black Metal überhaupt ausmacht. Sicherlich eine Haltung, die im Kern rebellisch ist. Dahingehend sind Wayfarer durch und durch Black Metaller, eben weil sie das Genre nicht dogmatisch ausschlachten. Daher passt die erwähnte Slide-Gitarre nicht nur sehr gut zur Ästhetik und den Themen von „American Gothic“, sondern ist als Stilmittel einer Rebellenhaltung innerhalb des Genres auch symbolisch relevant. Genauso wie die Texte weder mit bitterbösem Unterton, noch mit anklagender, stellenweise fast spöttischer Gesellschaftskritik sparen, entfalten die Songs eine ungeahnte Tiefe und reißen den Hörer förmlich mit auf ihrem Streifzug durch die dreckigen, verkommenden Seiten das ganz und gar nicht romantischen Wilden Westens. Das gesamte Album lebt von einer gespenstischen Aura, die sich gleichsam in einem Schlepper wie „Reaper on the Oilfields“ (inklusive verzerrt geflüstertem Gesang) findet, wie sie in dem Singer-Songwriter/Folk-Versatzstück „A High Plains Eulogy“ Gänsehautstimmung erzeugt. Ebendiese Stimmung ist das verbindende Element, das dafür sorgt, dass dieses Album, obwohl es nicht wirklich typisch schwarzmetallisch klingt, zu einer intensiven Reise durch finstere Emotionen wie Hoffnungslosigkeit und den Willen in einer lebensfeindlichen Umgebung zu überdauern wird. Hinzu kommt, dass die Gefühle, die diesem Album innewohnen, genauso wie seine Melodien von vorne bis hinten durch Mark und Bein gehen. Man höre nur mal das Akustikdrama „Black Plumes over God’s Country“.
7. The Night Eternal – Fatale

„Fatale“ muss den Beweis antreten, dass The Night Eternal nicht nur eine hell leuchtende Sternschnuppe am Himmel des dunklen Heavy Metal waren. Denn die superben Vorgänger (ein Album, eine EP) sorgten im Vorfeld für einigen Zugzwang, den die Essener aber mit Leichtigkeit meistern. Die Herren brennen ein Feuerwerk an okkult angehauchtem Heavy Metal ab, liefern dabei Melodien in Hülle und Fülle und wissen vom Start weg mitzureißen. Dabei nimmt der Opener „In Tartarus“ nicht nur als augenscheinlicher Hit (dieser Refrain) die Kraft der Scheibe vorweg, sondern zeugt vom Fleck weg davon, dass die Essener keine halben Sachen machen. Allzu offensichtliche Hits sind zwar keine auszumachen, aber das ist bei der Hookline-Dichte dieses Albums auch schwer. Hier brennt jeder Song als intensiv-okkultes Musikfeuer ein Loch ins Hörerherz und füllt es gleich darauf mit Enthusiasmus, Leidenschaft und der richtigen Portion Pathos, die zum Heavy Metal dieser Sorte dazugehört. Natürlich lebt die Musik maßgeblich von der charakteristischen Stimme von Ricardo Baum, aber seine Mitmusiker müssen sich keineswegs verstecken. Subtil treibende Nummern wie „Prince Of Darkness“ oder das unwiderstehlich melancholische „We Praise Death“ sind mit Herzblut gefüllte Heavy Metal-Hymnen für die kommende Ewigkeit und treffen sowohl zielsicher ins Herz eines jeden Headbangers mit Sinn für klassischen Heavy Metal, wie sie auch in der Lage sind eher düster veranlagten Gesellen die enthusiastisch geballte Faust zu entlocken. Unnötig zu erwähnen, dass Refrains von Nummern wie „Stars Guide My Way“ oder die Gitarrenarbeit im wehmütigen „Run With The Wolves“ ebenjene Elemente sind, die aus einem guten Album ein großartiges Werk machen. The Night Eternal liefern mit „Fatale“ ein mitreißendes Zweitwerk, das die Magie von Musik nahezu perfekt ausdrückt.
8. Predatory Void – Seven Keys to the Discomfort of Being

Irgendwo zwischen Eckpunkten aus teerschwarzem Sludge, Death- und Black Metal setzen sich Predatory Void mit ihrem Debüt „Seven Keys to the Discomfort of Being“ in die musikalischen Nesseln. Dabei steht natürlich die markerschütternde Stimme von Sängerin Lina R. im Mittelpunkt der Songs, bildet aber beileibe nicht das einzige Spannungsmerkmal der Musik. Dem Titel gemäß ist das Album ein Konzeptwerk, das in sieben Schritte bzw. sieben Songs unterteilt wurde. Diese bewegen sich mal in betörend-eklektischem Midtempo, tragen Züge von morastigem Sludge, brechen in manchen Momenten aber auch in Richtung Black Metal aus. Dabei wirkt die Atmosphäre dieses Albums auf Dauer schroff und hart, schlägt also eher mit der nackten Faust auf Beton, als dem Hörer die Wange zu tätscheln. Gleichzeitig sorgen manch reduzierte Anteile, wie der Klargesang im Schlussteil von „Endless Return to the Kingdom of Sleep“ oder das Akustikstück „Seeds of Frustration“ (der Klargesang geht unter die Haut) für eine beklemmend-verzweifelte Atmosphäre die ständige Züge von Qual, Kampf, Angst, Aggression und Verzweiflung in sich trägt. Ein Stück wie „The Well Within“ bündelt beispielsweise Blastbeats mit stählernen Sounds, die wirken als würden die Gitarrenseiten eher zum Strick im den Hals, als zart gestreichelt zu werden. Noch ein Stück qualvoller drückt „Shedding Weathered Skin“ aus den Boxen. Bleierne Schwere legt sich wie ein Würgegriff um die Psyche des Hörers, was, je nach Gemüt, schmerzhaftes Drängen oder doch befreiende Katharsis sein kann. Dabei lebt die Musik in Gänze von einem hypnotischen Element, einer tiefgreifenden Emotionalität die vom ersten bis zum letzten Ton durch Mark und Bein geht. Das atmosphärisch komplexe Klanglabyrinth „Funerary Vision“ bündelt all die Elemente dieses Albums nicht umsonst in einem stimmungsvollen Longtrack, der gleichsam kunstvoll faszinierend, wie auch emotional zermürbend ist und den Hörer geplättet zurücklässt. Grandioses Debüt!
9. Thy Art Is Murder – Godlike

Ungeachtet dessen, dass der Rauswurf von Frontmann CJ McMahon kurz vor Erscheinen dieses Albums ein ziemlicher Knieschuss für Thy Art Is Murder war, denn die sympathisch-deibelige Aura des Sängers kann eigentlich niemand ersetzen, ist „Godlike“ ein gewohnt brutales Brett, das in seiner physischen Form die wohl letzten Gesangspuren von CJ für Thy Art Is Murder bereithält. Dabei gelingt es der Band auf diesem Album so gekonnt wie selten zuvor ihre Deathcore-Wurzeln mit einer gewissen Komplexität zu vereinen. Die eindringlichsten Momente entfalten mitunter kleine Nuancen, wie die Melodien im stürmischen Opener „Destroyer of Dreams“, der besonders in Verbindung mit dem zermürbenden Finale „Bermuda“ wie ein Schraubstock wirkt, welcher den Geist des Hörers langsam zusammendrückt. Zwischen diesen beiden Ausgangspunkten speit CJ McMahon Gift und Galle, bündelt seine Wut und Frustration über die Gesellschaft in oft zynischen Texten wie „Blood Throne“ oder dem von knisternder Spannung durchsetzten Groove-Monster „Join Me In Armageddon“. Für diese Wirkung sind auch nicht zuletzt die Gitarren mitverantwortlich. Denn die Saitenfraktion legt diesmal noch mehr Wert auf eine Balance zwischen Riffs, die direkt in den Magen treten und unheilvollen Melodien, die sich immer wieder zwischen den monströsen Grooves hindurchschlängeln und dann wie aus dem Hinterhalt zupacken (u.a. in „Everything Unwanted“). In diesem Zusammenhang ist der düstere Brecher „Corrosion“ großes Kino. Hier wird, u.a. dank akzentuiertem Schlagzeugspiel, dem auch mal mit konsequentem aussparen der Riffwand genug Platz gelassen wird, sowie der erwähnten dunklen Melodik eine Stimmung zwischen Anspannung, Aggression und unbändigem Hass aufgebaut, die wie ein Tsunami über den Hörer hereinbricht. Da macht „Anathema“ als aufbrausender Bruder dieses Tracks gleich nochmal mehr Sinn, ehe das erwähnte „Bermuda“ seine dunkle Kraft freisetzt.
10. Maggot Heart – Hunger

Maggot Heart, respektive Linnéa Olsson klingen auf „Hunger“ immer noch sperrig. Gleichzeitig klingt dieses Album sowohl eine Spur drängender als der Vorgänger, wie sich ebenso ein sehr filigranes, kaputtes Element in der Musik findet. Dabei ist „Hunger“ kein zugängliches Album, spielt vielmehr bis zum Extrem mit Kontrasten und widersprüchlichen Gefühlen, ist aber gerade deshalb große Kunst, die sich kaum in ein bestimmtes Korsett pressen lässt. Die punkige Haltung der Künstlerin wird in jedem Song und jeder Note spürbar und mündet sowohl in drängenden Stücken wie „Looking Back At You“, die eine ähnliche Qualität wie Fingernägel auf einer Schiefertafel haben, als auch in einem verrucht wirkenden Düster-Punker wie „Parasite“, dessen Melodik wie ein aufgescheuchter Wespenschwarm im Ohr herumsaust. Der Opener „Scandinavian Hunger“ trifft die Dualität, die dem Hungergefühl innewohnt mit kratzbürstiger Energie auf den Kopf, lässt sowohl metallische Bläser-Ensembles, als auch dröhnende Bass-Vibes zu Schrammel-Gitarren zu und klingt damit so herrlich zerrissen, dass es einem die Haare zu Berge stehen lässt. Was dieses Album aber letztendlich so tiefschürfend macht, ist einerseits die Authentizität der Künstlerin, die hier ihr Herz in Musik blutet und andererseits die Tatsache, dass die Musik zu keiner Zeit vorhersehbar wirkt, den Hörer aber auf eine wilde Achterbahnfahrt der Klänge und der Gefühle mitreißt. Maggot Heart bauen mit „Hunger“ ihren Status als spannende Grenzgänger der Musiklandschaft weiter aus.
11. Uada – Crepuscule Natura

Uada reizen auf „Crepuscule Natura“ die stilistische Bandbreite zwischen Black Metal, Melodien, die deutliche Züge des klassischen Heavy Metal tragen und einer bittersüßen Melancholie, die nicht zuletzt mancher Death-Rock Anleihe geschuldet ist, weiter aus. Dabei entsteht innerhalb dieses Rahmens ein Abwechslungsreichtum, der den Hörer durch hochmelodische Astralreisen wie „The Abyss Gazing Back“, oder mit rasendem Kaltstoff der Marke „The Dark (Winter)“ mitreißt. Die Songs transportieren nach wie vor eine stolze Haltung, wirken aber vermehrt von einer melancholischen Note durchsetzt, sodass die (schon immer vorhandene) Bitterkeit des Uada-Sounds auf diesem Album stärker zutage tritt. Dieses Gefühl wird in den entsprechenden Momenten zwar auch von gewissen Epik konterkariert, aber einem Song wie „Retraversing the Void“ wohnt ein verträumt-melancholische Element inne, das speziell dieses Album verstärkt auszeichnet. Spätestens jetzt wird klar, dass Uada keine Scheu vor Entwicklung haben, denn wer klassischen Heavy Metal (die Gitarren), finster-erhabenes Brüllheulen (Uada eben…) und eine eigenwillig mystische Aura (wir sind wieder im Black Metal angekommen) so gekonnt verquickt, dem sei Erfolg und Respekt gegönnt. Allen Grund dazu liefert auch der Abschluss „Through the Wax and through the Wane“, der als zwölfminütige Astral-Abfahrt zwischen Melancholie, Twin-Gitarren-Exorzismus (diese Melodien!), sowie schwarzer Rasanz und einem erhaben-stolzen Finalpart alles bietet was Uada bisher für sich kultiviert haben. Darüber hinaus ist die optische Gestaltung einmal mehr eine Augenweide und repräsentiert den spirituell-philosophischen Aspekt der Band sowohl auf ästhetische Weise, als auch sehr passend im Kontext des bisherigen Schaffens der Amis.
12. Altari –Kröflueldar

Island steht seit einiger Zeit als Gütesiegel für spannenden und eigenwilligen Dunkel Metal, der sich immer durch eine gewisse Stimmung auszeichnet. Auch Altari hört man ihre Herkunft an und doch klingt „Kröflueldar“ anders, ist schwer einzuschätzen und deshalb völlig eigen. Die Band schafft es, trotz eines klaren und differenzierten Klangs, den Eindruck von diffuser Kälte, verwaschen-nebulösem Gletscher-Black Metal zu erzeugen. Dabei ist der schwarze Kern dieses Albums stets von einer fast post-punkigen, oder auch unkitschigen Gothic-Note durchdrungen. Dadurch wirkt dieses Debüt wie eine vertonte Geistergeschichte oder das klanggewordene Äquivalent zu finsteren Landesmythen. Daher verwundert es wenig, dass sich der Gesang als finsteres Spuktreiben im Kopf des Hörers breit macht, während die Musik wie ein schwermütiger und introvertierter Tanz am Abgrund wirkt. Interessant ist in diesem Fall auch das Schlagzeugspiel, das Genre-untypisch eher sanft-akzentuiert ausfällt, anstatt den Knüppel zu schwingen. Auch die Gitarren arbeiten vielfach mit unkonventionellen Mustern, die kaum einem gängigen Melodieverständnis folgen und eher dicke Soundteppiche weben. Das klingt ab und an disharmonisch, erzeugt eine beständige Beklemmung, geht aber zu jeder Sekunde unter die Haut. Ihr wollt freigeistigen Düster-Metal mit authentischer Haltung? Hier habt ihr ihn!
13. Urfaust – Untergang

Urfaust sind Geschichte. Der Teufel weint. Der Teufel trinkt sich in die Besinnungslosigkeit und schläft am urfaustschen Tresen bei Kerzenlicht ein…Ob aus Trauer über das Ableben des eigenwilligen Duos oder vor Erleichterung, dass der psychedelische Musikdrogentrip nun ein Ende hat, ist schwer zu sagen. Mutmaßlich trifft eher ersteres zu. Denn wer klangliche Höllendramen wie „Der Zauberer“ (auf dem Album „Der freiwillige Bettler“) erschaffen hat, der muss doch beim Herrn der Hölle einen Stein im Brett haben, oder? Fest steht, dass „Untergang“ die verschiedenen Facetten des Urfaust-Sounds sehr passend zusammenfasst, wodurch das Album fast als abschließender Bandkonsens durchgeht. Hier wechselt sich bedrohliche Drone-Brechstangenmusik der Marke „Höllenkosmos“ mit hexenhaftem Black Metal-Treiben der Marke „Vernichtung“ und „Leere“ ab. Dabei klingt alles an „Untergang“ nach Verzweiflung, nach purem Exzess im Gefühl des Abschieds und doch ist es kein depressives Album. Urfaust behalten auch mit ihrem Schwanengesang die Freude an der Verzweiflung bei, sodass der finale Sturz in den „Abgrund“ seinem Titel zwar gerecht wird, aber auch wie ein triumphales letztes Epos wirkt. Aus einer schwarzen Prozession voll von künstlerischer Besessenheit, hypnotischer Musik und pulsierendem Herzblut erwächst eine dröhnende Katharsis, der letzte Rausch, der den Verfall durch Ekstase zelebriert. Am Ende bleibt melancholische Leere und das Gefühl noch immer ein wenig im Gefühlsnebel dieses Albums fest zu stecken, womit Urfausts „Untergang“ einmal mehr ein cleveres und intensives Kunstwerk darstellt, dass durchlebt werden will und muss!
14. ArsGoatia – Hiding Amongst Humans

„Hiding Amongs Humans“ gemahnt dank seines Titels an eine unterschwellige, versteckte Bösartigkeit, die in Verbindung mit dem diabolischen Artwork nicht weniger als infernalische Musik verspricht. Dieses Versprechen halten ArsGoatia vor allem dadurch ein, dass schon mit den ersten Tönen von „Tongues Orifice Fire“ der Eindruck entsteht, hier im Höllenfeuer verkocht zu werden. Der Hörer findet wieder sich in einem sperrig-wüsten Aggressionsallerlei zwischen Black- und Death Metal, in dem sich Stimmung und Tempo teilweise überschlagen. Mit interessanten Details, wie chaotischem Maschinengewehr-Drumming zu unheilvoll durchdringender Melodiearbeit der Gitarren, öffnen ArsGoatia einen zerstörerischen Mahlstrom, der in jeder Sekunde einer emotionalen Katharsis gleicht und damit auch die spirituell-rituelle Herkunft der Band verdeutlicht (ArsGoatia gingen aus dem Split von Our Survival Depends On Us hervor). Der intensive Schleifer „When Heresy Repeats Itself“ bringt diese ungreifbare Aura auf den Punkt, vermählt das Feuer des Black Metal mit diversen ritualisierten Aspekten sowie doomiger Schwere und wird darüber hinaus, dank des psychotischen Geschreis auf eine gallige Spitze getrieben, die den künstlerischen Wahnsinn der Band verdeutlicht. Der beschwörend-finstere Charakter der Musik, lässt „Hiding Amongst Humans“ wie eine finstere und zutiefst persönliche Katharsis wirken, die nicht mit Szene-Klischees spart, diese aber sowohl kunstvoll, als auch authentisch darbietet. Am Ende besticht „Tyrant of all Men“ durch markante Riffs und einen durchdringenden Bass, der den Malstrom-Charakter der Musik nochmal deutlicht macht. Dabei klingen ArsGoatia mit jedem Ton morbider, wirken umso radikaler in ihrer Herangehensweise und scheuen auch die Atmosphäre des Post-Metal nicht. Die Österreicher müssen sich, entgegen dem Albumtitel sicher nicht hinter ihren Szenegenossen verstecken, denn „Hiding Amongst Humans“ ist als authentisch radikale Hass-Orgie mit tiefsitzendem Drang zu kreativer Freiheit sehr gelungen und überrascht mit der Vereinigung von scheinbarem Chaos und psychedelisch-rituellen Aspekten, die, obwohl garstig und gallig klingend, letztendlich viel weniger Krach sind als es zunächst scheint.
15. Blodtår – Det förtegna förflutna

Die Kombination von Black Metal und Folklore ist, je nach Betrachtungsweise, ein zweischneidiges Schwert. Einerseits laufen Bands wie Finntroll mit allzu Party-tauglichem Humppa-Metal immer wieder Gefahr, diese Kombination in ein etwas zu fröhliches (mancher würde auch lächerliches) Bild zu rücken. Andererseits gibt es auch Gesellen wie die Schweden Blodtår, die mit „Det förtegna förflutna“ ein Debüt am Start haben, das nordische Kälte, folkloristische Elemente (im Sinne der Landestradition/des Volksbrauchtums) und Black Metal-Raserei mit reichlich Melodien unter einen Hut bringt. Dabei wirkt das Album in seiner optischen Inszenierung durchaus naturverliebt, was sich auch in der Atmosphäre der Musik widerspiegelt. Vielfach erzeugt die Musik Stimmungen und Eindrücke von nächtlichen Waldbildern, Baumgeistern und allerlei Fabel- und Sagengestalten der nordischen Folklore und Mythologie. Die Band weiß aber der Verballhornung dieser Elemente entgegen zu wirken, indem sie ein weiteres musikalisches Äquivalent zu einem Herbststurm erschafft. Natürlich sind sie vorhanden, die beschwingten Folk-Melodien wie u.a. im Opener „En krona av is“. Aber gerade in den Momenten in denen die Geschwindigkeit angezogen wird und der Schlagzeuger sich austobt (u.a. „Den Fördärvande Sorgbundenheten“), bebt die schwarze Seele der Musik in garstiger Manier und die Gitarren schneiden sich mit eisigen Melodien durch den vertonten Herbststurm. Dabei behalten Blodtår über das gesamte Album die Balance zwischen ruppiger Raserei und einem gewissen märchenhaften Flair, das aber klar im Sinne der, oftmals grausamen Fabeln der nordischen Folklore zelebriert wird, statt Kindergeschichte zu sein. Hinzu kommt ein ausgeprägtes stolzes Element, das die Musik, aufgrund der Verbindung von traditionellen Instrumenten und rasendem Black Metal, sowie allerlei Melodien mit Bezug zu traditionellem Liedgut zu jeder Zeit packend wirken lässt. Diese Verbindung von musikalischer Traditionspflege in Form von mitreißenden, unvorhersehbaren Kompositionen und einem ausgeprägtem Bewusstsein für die eigenen Kultur, bzw. die Kultur des eigenen Landes, macht „Det förtegna förflutna“ zu einem spannenden Debütalbum, das durch und durch mitreißt.
16. Afsky – Om hundrede år

Irgendwo zwischen lebensmüder Stimmung und einem Händchen für schneidenden Black Metal setzen die Dänen Afsky ihre Duftmarke. „Om hundrede år“ ist durchweg von einem schmerzlichen Schleier verhangen, die Musik tönt immer ein klein wenig verwaschen und sticht durch ihre Stimmung immer wieder ins Herz. Dabei lebt das Album aber auch von einer stolzen Haltung, wodurch die klangliche Schwere nie weinerlich wirkt. Diese Qualität findet sich neben der bedrückenden, aber eben doch wunderschönen Melodiearbeit der Gitarren auch vermehrt im Gesang. Denn obwohl das klagende Geschrei durchaus schmerzerfüllt und lebensmüde klingt, wohnt ihm auch der zuvor erwähnte Stolz inne. Dieser Qualität ist es vielleicht auch geschuldet, dass dieses Album letztendlich wie ein Versuch der Akzeptanz wirkt. Das Leben ist ein Trauerspiel, destruktiv und wenig farbenfroh, denn es endet in der allgemeinen Tragik des Todes. Diese erdrückende Schwere der Endlichkeit lastet seit jeher auf jeder Existenz. Die thematische Nähe zum Nihilismus verwundert daher genauso wenig, wie der Umstand, dass die Melodien und Stimmungen tiefe Furchen in das Seelenkleid des Hörers schlagen können. Und doch findet die Musik letztendlich ihren Frieden, wie auch das Leben im Tod Frieden finden kann. Denn die auf dem Cover dargestellte Geste des Abschieds hat fast etwas Liebevolles. Ob hier letztendlich aus Trauer eine Katharsis erwächst, ist aber sicherlich eine Gemütsfrage. Dnn die Musik liegt, egal wie anmutig und stolz sie auch scheint, doch wie ein Stein im Magen.
17. Arkona – Kob

Von partytauglichem Wochenendpaganismus ist auf Arkonas neustem Streich „Kob“ nichts mehr zu spüren (falls solche Anwandlungen überhaupt jemals in der Musik der Russen stattfanden). Stattdessen zeichnet sich das Album durch eine finstere, fatalistische Stimmung aus, die vielfach wie eine vertonte Dystopie wirkt. Das beginnt beim monochromen Artwork, das in gewisser Weise den Weg vom Kind zum eigenen Teufel darstellt, erstreckt sich über den vermehrten Einsatz von elektronischen Elementen, die eine fast feindliche Kälte ausstrahlen (u.a. erweckt das blechern verzerrte Intro/Outro den Eindruck von Propaganda-Staatsfunk-Sprech) und findet seinen dunklen Höhepunkt in den Texten, die es wert sind durch den Übersetzer gejagt zu werden. Denn Zeilen wie: „…Du atmest das Gift deines Schöpfers ein. Durch Schmerz und Lecken deiner Wunden, rennst du wie ein Tier zum Fallensteller. Stinkendes Aas winkt, frisst die Knochen der ewigen Kriege. Du wartest auf das Ende…“ (aus „Ugasya“) vermitteln einen gewissen Eindruck von der Sprachgewalt, mit der Frontfrau Masha hier zu Werke geht und dabei kein gutes Haar an der Menschheit lässt. Dieser pessimistische Grundton wird von einer beklemmenden Atmosphäre mit jedem Song weitergetragen, wobei sich Masha klar im Zentrum des Geschehens platziert. Dabei wirkt die Musik durchweg finster, schlägt einige Haken, die in einem Song wie „Mor“ in akustische Melodien traditioneller Instrumente münden, sich zwischendurch in vertrackter Schwärze suhlen, aber stets von einer melancholischen Stimmung durchzogen werden. Mit dem Zwölfminüter „Ydi“ liefern Arkona außerdem einen vielfältigen Brecher mit Hang zur Theatralik ab, indem sie von emotional aufgeladenen Gitarrensoli, über variables Flüster-Grollen im Gesangsbereich und einen traditionell folkig wirkenden Mittelteil, bis hin zum schwarzmetallisch flirrenden Finale sämtliche Elemente unter einen Hut bekommen. Am Ende gewinnt dieses Album nicht nur durch seiner Atmosphäre stetig an Dringlichkeit, sondern überzeugt durch variables Songwriting, das in Songs wie „Razryvaya plot‘ ot bezyskhodnosti bytiya“ zwischen Piano-Melancholie, Black Metal-Blasts und traditioneller Instrumentierung pendelt und dabei kaum Hoffnung zulässt, vielmehr jeden Funken darauf zu Staub zerreibt. Damit geht „Kob“ als fesselndes Extrem-Metal Werk über die Ziellinie, mit dem sich Arkona sämtlicher Genre-Schubladen entledigt haben.
18. Enslaved – Heimdal

Dass Enslaved schon lange keine Black Metal Band mehr sind, sollte klar sein. Und auch mit „Heimdal“ sprengen sie einmal mehr die Grenzen zwischen urwüchsiger Naturverbundenheit, Komplexität und Musik, die es trotzdem schafft auf emotionaler Ebene zu berühren. Songs wie „Forest Dweller“ warten ebenso mit progressiven Arrangements und wilden Keyboard-Abfahrten auf, wie sich beinahe ohrenschmeichlerische Gesangsparts und sanfte Melodien finden lassen. In „Caravans to the outer Worlds“ treffen trippige Synthesizer auf harte Gitarrenriffs und garstige Black Metal Vibes werden von Instrumenten wie einem Schellenkranz oder atmosphärischem Klargesang konterkariert. Dabei bleibt der Song aber erstaunlich rhythmisch und wirkt in all seiner Kleinteiligkeit stets nachvollziehbar. Und obwohl hier ein einzelnes Stück oft mehr Wendungen vollzieht, als andere Bands auf ganzen Alben zustande bringen, ist „Heimdal“ in Gänze relativ einfach zu verdauen. Natürlich ist diese Musik kopflastiger und vielschichtiger als es viele Vertreter der schwarzen oder paganistischen Zunft je sein werden. Aber genau diese Verbindung von Progressivität, farbenfroher Inszenierung und einem trotzdem rauen Kern, der den schwarzmetallischen Ursprung dieser Norweger, wenigstens in Nuancen, noch immer erkennen lässt, sind die Zutaten, die Enslaved auf auf eine spezielle Weise einzigartig, vielleicht auch eigenartig machen. Dabei klingt die Musik stets authentisch und das Feuer für die eigene Kunst ist zu spüren. Musik muss nicht einfach sein, sie muss den Hörer auf eine gewisse Weise berühren. Und auch wenn es hier ein wenig dauern kann, bis der Funke überspringt, „Heimdal“ kann als wendungsreiches Allerlei zwischen Progressivität und Garstigkeit durchaus Spannung erzeugen.
19. Betontod – Zeig Dich!

Ja, „Zeig Dich!“ ist auch ein politisches Album, wie Betontod im energischen Titeltrack klarstellen. Damit können Künstler schnell mal auf die Nase fallen. Auch weil im Punkrock allgemein eine Anti-Faschismus-Haltung propagiert wird, die ihren Fokus zu sehr auf den vermeintlich rechten Rand richtet, dabei aber übersieht, dass z.B. von der politischen Linken, oder globalistisch orientierten Politikkaspern und NGOs ähnlich freiheitsfeindliche Ansichten vertreten werden, wie sie den konservativen Kräften der Politik gerne unterstellt werden. Im vorliegenden Fall umschiffen Betontod solche Diskussionspunkte gekonnt, indem sie z.B. mit Nummern wie „Tanz im Algorithmus“ nicht nur die Fesseln des digitalen Zeitalters kritisch betrachten, sondern damit auch einen ebensolchen Kommentar zum gesellschaftspolitischen Zeitgeist abgeben, dessen Unterton grundsätzlich für eine generelle Selbstbestimmung Position bezieht. Aber auch die menschlichen Seiten des Lebens sind nach wie vor Kernthemen der Betontodschen Musikformel, die mit „Nie mehr St. Pauli ohne dich“ oder „Diese Liebe“ zwei lebensnahe Kracher zwischen Liebe, Alltagstrauer und einem unbeugsamen Willen zum Leben bereithält. Überhaupt ist die Ohrwurmdichte auf „Zeig Dich!“ so hoch wie auf keinem der letzten regulären Studioalben der Band (von den „B-Seiten“ mal abgesehen). Da darf sich auch mal das eine oder andere NDW-Zitat in die Musik schleichen („Neonlicht“), oder kräftig in Richtung der Finanzsklaverei ausgeteilt werden („Das Kapital“). Denn was alle Songs dieses Albums eint, ist eine rebellische Energie, der Freiheitsdrang, der ja immer auch zum Punkrock dazu gehört. Gleichzeitig zündet hier einfach jeder Song und es findet sich nicht eine Nummer die stimmungstechnisch abfällt. Selbst der pathosschwangere Balladenabschluss „Mehr als Legende“ ist hörbar in Herzblut getränkt und macht als Bekenntnis zur eigenen Kämpferhaltung durchaus Sinn.
20. Memoriam – Rise to Power

Abgesehen davon, dass Politik, egal in welchem Kontext, immer ein Streitthema sein wird (u.a. auch weil über ein offensichtliches Kontrollsystem gestritten wird, ohne die generelle Notwendigkeit dessen infrage zu stellen), liefert Memoriams „Rise to Power“ eine bekömmliche Death Metal-Vollbedienung. Lässt sich über die eine oder andere Bezugnahme zu vermeintlicher Historie sicher streiten, ist das auf Seiten der Musik wohl kaum der Fall. Von einer melancholischen Grundstimmung durchzogen, grooven sich Memoriam durch das wohl vielfältigste Album ihrer bisherigen Karriere. Während ein Song wie „Total War“ einmal mehr mit unwiderstehlicher Intensität in Sachen Gitarrenmelodien und beklemmender Harmonien über den Hörer hinweg rollt, wildert „I Am The Enemy“ gar in unheilvollen Doom-Gefilden und vermag dank elegischer Melodien einen gewissen Kloß im Hals des Hörers zu erzeugen. Aber auch wenn Memoriam das Tempo anziehen bleibt die zermürbende Stimmung erhalten. „Annihilations Dawn“ etwa stellt den Offensiv-Charakter der Musik in den Vordergrund und birgt reichlich Headbang-Potenzial, sowie packende mehrstimmige Melodiearbeit der Gitarristen. Dass aber mittelschnelle Walzensongs immer noch die wahre Stärke von Memoriam sind, zeigen Nummern wie „All Is Lost“. Nicht nur hier glänzt Karl Willets als eine der charakteristischsten Stimmen der Todesbleiszene, sondern vermittelt auch eine beinahe nihilistische, mindestens aber hoffnungslose Atmosphäre, die dem Titel mehr als gerecht wird. Daran sind auch die Gitarristen nicht unschuldig, denn diese unheilvoll-beklemmende Melodik, die sich durch den ganzen Song zieht, vermag einem schon die Haare ein paar Momente lang zu Berge stehen zu lassen. Der Knackpunkt des Albums ist aber sicherlich die Bezugnahme zu aktuellen Konflikten wie dem Ukraine/Russland-Thema, das (wie jeder Krieg) von reichlich Propaganda und anderen informativen Grenzwandlungen durchseucht ist, sodass die Trennlinie zwischen Wahrheit und Lüge weniger klar auszumachen ist, als viele glauben wollen. Davon abgesehen ist „Rise to Power“ aber ein starkes Stück Death Metal, das mit „This Pain“ einen stetig intensiver werdenden Abschluss bereithält, der einem Schlag in die Magengrube gleichkommt. Unterm Strich ist auch dieses vierte Memoriam-Album ein Sahnestück lawinenhaften Todesbleis, dass Abwechslung im Memoriam-Kosmos bisher nie so groß geschrieben wurde wie hier, zeugt außerdem davon, dass die Band ihre Geschichte noch lange nicht auserzählt hat.
Dominik Maier