In diesem Jahr fällt es noch schwerer als bisher die Menge an qualitativ hochwertigen Veröffentlichungen im Hartwurst-Sektor auf 20 repräsentative Scheiben einzudampfen (die Plätze dieser Liste sind untereinander beliebig austauschbar). Daher ist dieser Beitrag eher ein Auszug aus einem Jahr voller musikalischer Hochkaräter. Aber ein solches Problem ist allemal besser als sich mit nur einer Hand voll guter Tonträger aus dem Jahr zu verabschieden. Deshalb: Vorhang auf für einen schmalen Blick auf einige Highlights des Musikjahres 2022.
1. Crone – Gotta Light?

Ob der Abgesang von Phil Jonas bisherigem Hauptprojekt Secrets Of The Moon einen direkten Einfluss auf „Gotta Light?“ hatte, ist erstmal nicht offensichtlich. Allerdings wirkt das Zweitwerk seiner bisherigen zweit- und jetzt Hauptband Crone wie eine emotionale Berg- und Talfahrt, die diese Gefühle von Abschied und Trauer, aber auch von Erleichterung und Dankbarkeit in einem emotionalen Strudel aus musikalischer Dunkelheit und dem hellen Licht der Hoffnung vertont. Grundlegend sind Crone in einem Hybridfeld zwischen Dark-Rock/Post-Rock und einer gehörigen Portion Düsternis zu verorten. Dazu gesellt sich eine gewisse romantische Ader, was die Stimmung dieses Albums oft wie hin- und hergerissen zwischen zwei gegensätzlichen Polen erscheinen lässt. Beispielhaft lässt sich dieser Spreizschritt an einem Song wie „Gemini“ festmachen. Im Kern wirkt das Stück zerbrechlich und intim, entfaltet aber durch das emotionale Gitarrenspiel und Phils Gesang eine breitwandige Dynamik, die am Ende von einem Bläser-Ensemble in fast lichte Sphären geführt wird. Dieses Spiel mit Licht und Schatten, der Brücke zwischen aufwühlender Energie und dem totalen Gefühlsscherbenhaufen, macht „Gotta Light?“ zu einem Album, das den Hörer mitten ins Herz trifft und auf eine emotionale Reise mit ungewissem Ausgang mitreißt. Und doch ist dieses Werk wohl auch als trotzige Fackel für das Leben zu verstehen. Selbst wenn dieses Leben nicht zwangsläufig dem menschlichen Durchschnittsgeist entspricht. „I don’t know where I lost my mind-come back to life…“ singt Phil Jonas in „Waiting for Ghosts“, womit er vielmehr eine Geisteshaltung und Herzensposition beschreibt. Denn das innere Feuer dieses Künstlers brennt nach wie vor. Und doch wirkt die Emotionalität in Teilen wie zerbrochen, was (nicht nur) im „Silent Song“ in einem Ritt auf der Rasierklinge mündet. Damit ist „Gotta Light?“ ein Album das einem Gefühlsrundumschlag gleicht, ohne diese Emotionen am Ende klar aufzulösen. Daher: Suchtgefahr!
2. Nubivagant – The Wheel and the Universe

Muss Black Metal Frost und Kälte oder Satanismus und Feuer predigen um true zu sein? Gemessen daran, dass eine der einflussreichsten Szene-Bands von schepperndem Satansgedöns bis zu einem epischen Viking Metal-Gottwerk wie „Hammerheart“ in ihrer Diskografie beides vereinen konnte, lautet die Antwort: Nein, Schwarzmetall ist nicht zwingend Satansmusik und noch nicht mal zwingend aggressiv. Vielmehr ist es die unberechenbare Atmosphäre die das Genre auszeichnet und natürlich das Herzblut der Künstler. Black Metal will und muss emotionale Reaktionen hervorraufen. Damit sind wir bei „The Wheel and the Universe“ angelangt, dem Zweitwerk das Multiinstrumentalist und Einzelkämpfer Omega unter dem Banner Nubivagant dieses Jahr hervorbrachte. Gleich vorweg: Der Spagat zwischen Tradition und Innovation, bzw. wirklicher Eigenständigkeit der hier gelingt ist fantastisch und zeugt nicht zuletzt davon, dass hier ein Herz für seine Sache blutet. Das auffälligste Charakteristikum der Musik ist sicher der klare Gesang, der sich stilistisch auch gut im klassischen Doom Metal verorten ließe. Dazu gesellt sich eine mitunter monotone Riffgewalt, die weder klassisch frostig, noch feurig erbost tönt, sondern dank einem repetitiv-rituellen Charakter nah an der Hypnose verortet werden kann. Dabei vermag die Musik drängend aufzustacheln (u.a. „Clothed with the Sun“), genauso wie sie, dank repetitiver Eindringlichkeit, apathisch und entrückt wirkt („The Mask and the Devil“). Nicht nur durch diese Charakteristik wirkt „The Wheel and the Universe“ in Gänze wie ein Feld voller Energie, dass den Hörer vollkommen vereinnahmt. Zwischen der Faszination für ferne Welten und dem Gegensatz der eigenen Vergänglichkeit, sowie dem emotionalen Graben zwischen universeller Unendlichkeit und der Gewissheit des eigenen Ablebens fließt dieses Album direkt ins Herz, wo es sich beinahe ehrfürchtig breitmacht und den inneren Blick auf das Potenzial der eigenen Träume richtet. Da soll nochmal einer sagen Black Metal sei dogmatische Schwarzmalerei. Nubivagant zelebrieren emotionale Dringlichkeit zu hypnotisch-rituellem Klang, fesseln vom ersten Ton an und bereiten der Gänsehaut Gänsehaut.
3. Ghost – Impera

Auf „Impera“ gehen Ghost bewusst einen Schritt zurück zu einer etwas weniger Pop-orientierten Ausrichtung der Songs. Aber stopp: Selbstverständlich werden liebgewonnene Trademarks nicht verworfen, im Gegenteil, hier jagt eine Monster-Hook die nächste. Allerdings groovt das Material in Gänze etwas erdiger, was die Inszenierung auf den ersten Blick ein kleines bisschen weniger opulent erscheinen lässt. Allerdings verfliegt dieser Eindruck so schnell wieder, dass er fast als irrelevant abgetan werden kann, denn in Sachen Hymnen hat die Band nichts verlernt. Das beginnt beim brillanten Intro „Imperium“, dem mit „Kaisarion“ ein kraftvoller Pop-Ohrwurm allererster Güte folgt. Hier schreit alles ‚Stadion-Rock‘ und die Hook und Gitarrenmelodien brauchen genau einen Durchlauf um das Langzeitgedächtnis zu belagern. „Spillways“ schlägt ein Rad hin zu tanzbaren Disco-Vibes, bleibt mit seinem Refrain aber so hartnäckig im Ohr kleben, dass man den Song einfach lieben muss. „Call Me Little Sunshine“ bietet dann das Dynamik-Gold, das diese Band so perfekt beherrscht, ehe „Hunter’s Moon“ jede Halle, ach was jedes heimische Wohnzimmer mit dem sprichwörtlichen Live-Feuer entzündet. Danach wird’s ein bisschen anspruchsvoller: „Watcher In The Sky“ hat nicht nur einen intelligenten und mehr als relevanten Text, sondern stellt sich auch als stetig heller schimmerndes Musikgold heraus (man beachte z.B. einen Durchlauf lang nur die Gitarrenmelodien…). Das sanft-sakrale „Dominion“ täuscht dann eine Andacht an, ehe „Twenties“ als stoischer Stampfer mit Walpurgisnacht-Stimmung daherkommt. Auch hier: Ohren auf für den Text…Und dann: „Darkness at the Heart of my Love“. Diese knapp fünfminütige Ballade, schafft es die Nackenhaare konstant im Spalier stehen zu lassen. Wer jetzt aber Kitsch wittert liegt falsch, denn wieder ist es der Text, der durchaus zum Nachdenken anregen kann. Das geht auch während man sich fast wie in Trance in der musikalischen Schönheit verliert. Das folgende „Griftwood“ schmeichelt als lockerer Melodic-Rocker mit „Unterstützer-Lyrics“ (…„I’m your rock baby, I won’t back down…) Herz und Ohr, ehe das Grande Finale „Respite on the Spiralfields“ (inklusive Interlude „Bite Of Passage“) eine gewisse „Jack the Ripper“-Thematik aufweist. Hier zeigt sich nochmal, dass Ghost niemals die große Gestik und große Inszenierung scheuen, sich gegenteilig wohlig darin suhlen und dadurch Hymnen für die Ewigkeit schreiben. Ghost untermauern auch mit „Impera“ ihren Status als einer DER Musik-acts unserer Zeit. Sie bleiben in ihrer Inszenierung überlebensgroß und in ihrer Musik beinahe unangreifbar, was einen Vergleich innerhalb der Diskografie dieser Band überflüssig macht.
4. Brutus – Unison Life
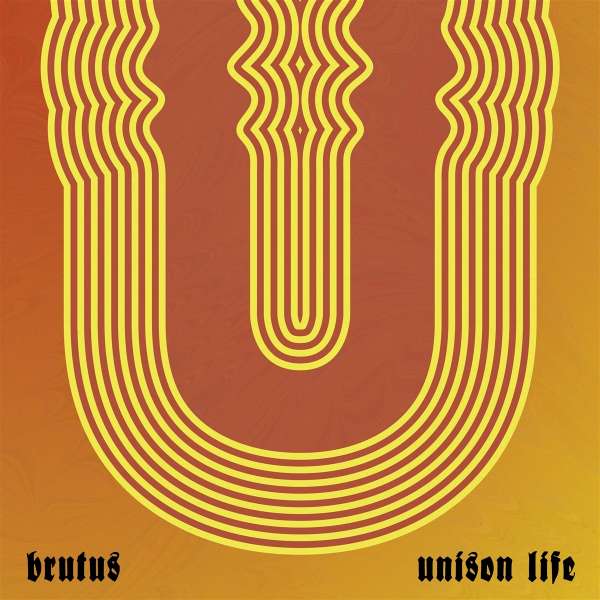
Der Sound von Brutus war schon auf den beiden Vorgängeralben mit gewissen Zwischentönen gespickt, aber auf „Unison Life“ wird diesen schwer greifbaren Emotionen deutlich mehr Raum eingeräumt. Insgesamt klingen die Belgier auf ihrem dritten Streich eine ganze Ecke epischer als noch in der Vergangenheit. Das liegt u.a. daran, dass es dem Trio in sämtlichen Songs gelingt die vielen Elemente ihres Sounds zu einem noch schlüssigeren und damit stimmungsvolleren Ganzen zusammen zu fügen. Dabei klingt das Album in Gänze deutlich differenzierter, wodurch besonders die Emotionalität diverser Zwischentöne, aber auch die des immer noch unverkennbaren Gesangs noch mehr in den Vordergrund tritt. Stilistisch entzieht sich „Unison Life“ sämtlichen Vergleichen und pfeift auf Genre-Grenzen. Der Albumtitel ist sicher auch kein Zufall, denn alles in allem wirkt das Album in seiner Emotionalität wie ein Plädoyer an und für das Leben. Ein Leben in persönlicher Freiheit, ein Leben voller individueller Entfaltung. Diese Kombination von Text, musikalischer Energie und der unverkennbaren Stimme von Sängerin/Drummerin Stefanie lässt einen Song nach dem anderen zu emotionalen Feuerwerken werden. Ganz groß ist in diesem Zusammenhang z.B. „Liar“. Aber auch das balladeske „What Have We Done“ trifft ins Herz, sticht, kratzt und klingt doch wunderschön. „Chainlife“ bringt sogar einen sehr positiven Charakter in das Album ein. Nach dem shoegazigen Beginn holzt Punk n‘ Roll-Groove los, plötzlich ergeht sich die Musik in zähen Breaks, ehe der Gesang viel Licht und Hoffnung suggeriert, daran ändert auch der wiederkehrende Groove nichts, im Gegenteil: Das Ende verspricht sowas wie den Drang zur Freiheit. Da macht „Storm“ gleich weiter und gräbt sich hartnäckig in den Gehörgang, wirkt aber eher wie die Vertonung eines inneren Sturms oder wie die Story eines überlebten Lebens, als nach musikalischem Wirbelwind zu klingen. Mit deutlicher Tendenz gen Shoegaze wirkt „Dreamlife“ zugleich wunderschön poetisch und aufgekratzt punkig. Am Ende gibt’s die große Emotionskeule und die Frage „Do You feel fine?“ Ja, denn nach dem finalen „Desert Rain“ kann das Fazit zu diesem Album nur großartig ausfallen. Auf „Unison Life“ bieten Brutus ein Dynamikfeuerwerk, das seinesgleichen sucht und auf sämtlichen Ebenen Gold wert ist.
5. Panzerfaust – The Suns of Perdition, Chapter III: The Astral Drain

In Sachen progressiver Finsternis liefern Panzerfaust mit ihrem dritten Teil der „The Suns of Perdition“-Tetralogie eines der eindringlichsten Alben des Jahres ab. Die Kanadier zelebrieren trostlose Musik mit Köpfchen, die dank philosophischem Textansatz immer wieder aufhorchen lässt. Die Schwermut des Albums ist natürlich auf die Texte zurückzuführen, aber die Tatsache, dass sich die Songs wie erkaltende Lava langsam aber stetig über den Hörer ergießen, ihm einen Gefühlscocktail aus Angst und Beklemmung einflößen, ohne auch nur ansatzweise einen Funken Hoffnung zuzulassen, ist gleichermaßen beeindruckend wie zermürbend. Oft haben die Riffs einen rhythmisch repetitiven Aufbau, steigern sich aber auf einen Höhepunkt hin, der in vielen Songs nicht sofort erkennbar ist, aber doch das Gefühl hinterlässt hier gerade einen Schlag in die Magengrube abbekommen zu haben. Die Musik gräbt sich in die Seele und Panzerfaust suggerieren einen Tanz auf dem Vulkan. Sicherheit? Fehlanzeige! Vorhersehbarkeit? Vergesst es! Schon der Opener „Death-Drive Projections“ wirkt wie eine vertonte Trance. Rituell anmutende Drums, hypnotische Gitarrenleads und dieses beschwörend finstere Organ, das sich, wie die Klauen einer Bestie, schmerzhaft aber faszinierend im Kopf breitmacht. Dass dieser Zwölfminuter, trotz seines sich wiederholenden Charakters, kaum spannender sein könnte, zeigt, dass diese Kanadier ganz genau wissen was sie wie beim Hörer hervorrufen wollen und können. Dass sich Panzerfaust gerne viel Zeit lassen um die Emotionalität ihrer Musik aufzulösen, zeigen sie auch im passend betitelten „Bonfire of Insanities“. Es klingt nach Schmerz und Seelenqual und doch ist die Band meilenweit von Selbstaufgabe oder dergleichen entfernt. Der Song brodelt als beschwörende finstere Messe auf, deren ritueller Charakter besonders vom zweistimmigen Gesang herrührt. „The Far Bank at the River Styx“ schlagwerkt als abwechslungsreicher und clever arrangierter Longtrack über die zwölf-Minuten Marke. Die Spannung ist kurvenreich arrangiert und der Song entfaltet eine destruktive, aber machtvolle Stimmung die beeindruckt. Hinzu kommen Gitarrenleads, die nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen sind und den unverkrampft brachialen Zwiegesang immer wieder einlullen, loslassen und dann doch wieder eisig voran peitschen. Die vier atmosphärisch, wie kompositorisch clever arrangierten Zwischenspiele sorgen außerdem für andauernde Spannung, obwohl sie allesamt ruhig, fast meditativ klingen. Auch deswegen entpuppt sich „Tabula Rasa“ als eindrückliches Final-Statement, das trotz bösartiger Wucht doch unverschämt catchy daherkommt. Müsste ein bildhafter Vergleich her, wäre es wohl der eines Vulkanausbruchs. Schön anzusehen aber von einer zerstörerischen Kraft, die alles unter sich begräbt.
6. Celeste – Assassine(s)

Hardcore mit Black Metal-Attitüde? Oder eher Post-Black Metal? Oder Sludge? Oder doch alles zusammen? Wirklich einfach zu schubladisieren waren Celeste eigentlich noch nie, mit „Assassine(s)“ dehnen sie den eigenen musikalischen Horizont aber noch weiter aus und das, obwohl sich gar nicht soviel verändert hat. Die Musik deckt von ultrabrutalem Riffing bis hin zu verträumter Melodik sämtliche Facetten metallischer Sounds ab und ist gleichzeitig mit einer künstlerischen Tiefe gesegnet, die das Album dauerhaft spannend gestaltet. Dabei spielt auch die visuelle Ästhetik der Band eine nicht unerhebliche Rolle. Denn sowohl das Album-Artwork, als auch die Musik vermitteln ein Gefühl von Schönheit, von Vollkommenheit in deren krassem Gegensatz die intensive Musik auch das Gefühl erzeugt von einem Strudel aus belastender Negativität aufgerieben zu werden. Das hat aber auch etwas Kathartisches. Hier wird innere Schwere mit äußerer Schwere bekämpft. Die eigene Tristesse wird am ergrauten Schleier des Alltagstrotts aufgeknüpft und der daraus entstehende Schmerz bestätigt das Gefühl am Leben zu sein. Damit ist „Assassine(s)“ eine Tour de force von höchstem künstlerischem Anspruch. Intensiv, fesselnd, fordernd und nicht ganz einfach zu verdauen. Aber Kunst soll nicht einfach sein. Die Antwort auf die Eingangsfragen lautet demnach: „Assassine(s)“ ist all das und noch viel mehr.
7. Sonja – Loud Arriver

Sonja liefern mit „Loud Arriver“ feinsten Stahl traditioneller Machart ab, schielen aber mit einem Auge immer gen Classic Rock und Konsorten, was ihre Musik dann doch nicht mehr ganz so traditionell klingen lässt. Das Album lebt von seinem leicht verruchten Charme und einer beinahe unverschämten Sexyness, die sich u.a. in Genre-Hybiden wie „Pink Fog“ (stadiontauglicher Rock trifft auf textliche Depression) oder treibende Rocker der Marke „Wanting Me Dead“, die zwar diverse negative Erfahrungen von Frontfrau Melissa Moore verarbeiten, aber eben auch zeigen, dass die Sängerin letztendlich aus allem gestärkt hervorgegangen ist. Auf musikalischer Ebene strahlen viele der Songs auf „Loud Arriver“ auch eine trotzige „jetzt erst recht“-Attitüde aus, was eine gewisse charakterliche Nähe zum Punk erkennen lässt. Allerdings übertreiben es Sonja nicht indem sie über die (musikalischen) Stränge schlagen, sondern ergehen sich vielmehr in bittersüßer Düsternis aus der letzten Endes eine Menge Kraft gezogen wird. Die leicht verruchte, dreckige Ästhetik lässt „Loud Arriver“ außerdem in einem schillernden Zwielicht erscheinen, das sich in stimmungstechnischer Hinsicht auch sehr gut auf die Musik übertragen lässt. Damit sind Sonja manchmal verstören, immer betörend und werden von einer süßlich aufdringlichen Aura umgeben, die perfekt zu den Songs passt. Dass das Album außerdem mit schmissigen Melodien und dem ein- oder anderen tanzbaren Groove vollgepackt ist macht’s nur noch besser.
8. Behemoth – Opvs Contra Natvram

Mit ihrem „Werk gegen die Natur“ wandeln Behemoth auf einem ähnlichen Pfad wie mit dem Vorgängeralbum, schaffen es aber ihre Musik mit einer Dringlichkeit und atmosphärischen Dichte darzubieten, wie es zuletzt auf ihrem Schlüsselwerk „The Satanist“ der Fall war. Der Grund dafür ist u.a. die stringente musikalische Geschichte die „Opvs Contra Natvram“ vom dramatisch aufgeladenen Intro „Post-God Nirvana“ an erzählt. Dass „Malaria Vvlgata“ danach das typische Black/Death-Sperrfeuer bietet, ist erstmal keine große Überraschung. Die findet sich eher in Stücken wie „The Deathless Sun“, das zwar als dunkel-majestätische, Hymne daher kommt, aber eben auch sehr detailreich durchkomponiert ist. Diese Balance aus erkennbarer technischer Klasse (exemplarisch dafür stehen die Drums auf dem kompletten Album) und der überlebensgroßen Inszenierung der Musik ist es, die Behemoth aus künstlerischer Sicht immer noch speziell macht. Das bedeutet auch, dass sich die Musiker eben nicht nur von ihrer hässlich-schwarzen Seite zeigen, im Gegenteil: Viele Momente des Albums atmen einen regelrecht rockigen Vibe, der aber immer der blasphemisch-bösen Ader der Band entspringt. Die Konsequenz daraus ist, dass ein Song wie „Neo-Spartacvs“ trotz kämpferischer Haltung sehr eingängig daherkommt. Wohingegen das folgende „Disinheritance“ kälter wirkt und u.a. die Kernfrage stellt, was Freiheit überhaupt ist. Solche Fragen aus dem Mund von jemanden wie Nergal, wirken – gerade angesichts seiner Äußerungen zu Themen wie der Covid-19 Impfung oder dem Ukraine-Konflikt – doch ein wenig paradox, denn in seinen Aussagen zu diesen Themen bezieht er fast durchgängig Position zugunsten der als „normal“ propagierten Meinung (um hier mal deutlich zu werden: Pro Impfung, pro Ukraine). Ob das kämpferische „Off to War!“ ursprünglich mit diesen Hintergedanken geschrieben wurde, darf demnach diskutiert werden. Dass der Frontmann aber nicht müde wird (vor allem live) im Kontext dieses Songs seine pro-Ukraine-Haltung zu verdeutlichen, hinterlässt doch einen etwas schalen Beigeschmack. Denn es erweckt den Eindruck, dass sich Nergal als öffentliche Person und vor allem als Künstler, der immer wieder die Wichtigkeit des Individualismus betont, vor einen Karren der Meinungsmache spannen lässt, ohne die genauen Hintergründe und Zusammenhänge zu kennen, bzw. ohne sie in der Öffentlichkeit zu erklären (sollte er sie doch kennen). Dass der punkige Vibe des Songs trotzdem mitreißt, spricht wenigstens für die Musik. „Once Upon a Pale Horse“, „Thy Becoming Eternal“ und vor allem „Versvs Christvs“ bilden schließlich das eindrückliche Finale eines beeindruckend finsteren Albums, das dank Detailreichtum und kompositorischer, sowie stimmungstechnischer Finesse als eines der ausgefeiltesten Werke der Polen gewertet werden muss.
9. Callejon – Eternia

Auf „Eternia“ malen Callejon noch schwärzer als in der Vergangenheit, gleichzeitig wurde gehörig an der Brutalitätsschraube gedreht, sodass die Songs anno 2022 noch finsterer klingen als auf dem bereits superben Vorgänger. Dazu tragen natürlich auch die Texte bei, die dem Albumkonzept folgend, immer mal den „Masters of the Universe“ Tribut zollen, aber auch viele Bezüge zum gesellschaftlichen Wahnsinn der letzten Jahre bereithalten. Das ändert aber nichts daran, dass die Sprache der Songs stets Raum für Interpretation lässt. Ein Track wie das atmosphärische „Mary Shelly“ verneigt zwar vor der gleichnamigen „Frankenstein“-Autorin, könnte aber u.a. auch Assoziationen zum Zwiespalt eines schizophrenen Geistes wecken. Im „Emokeller“ liegen dagegen die Anti-Gefühle gegenüber der Gesellschaft, aber auch das Misstrauen gegenüber sich selbst verborgen. Musikalisch rollt der Metalcore-Zug mit Vollgas voran, zieht aber immer wieder die Handbremse um im Refrain mit eingängigen Gesangslinien Luft zu schaffen. Hart aber tief melancholisch gräbt sich hier der Magen um. Wer die textlichen Bezüge zu den „Masters of the Universe“ nicht nachvollziehen kann (so wie der Autor dieses Textes), findet in einem Song wie „Scareglow“ trotzdem reichlich einprägsamen Stoff. Die Musik prügelt im stop-and-go-Modus nach vorne, vor allem die Strophen ballern ohne Ende, bevor sich der Refrain zwar nicht minder aggressiv gibt, aber eben auch mit einer gehörigen Portion Melancholie und Eingängigkeit aufwartet, sodass der Song durchaus einige Zeit im Kopf bleibt. Ein wirkliches Glanzstück gelingt Callejon aber mit dem Trauerkloß „Ich komme niemals an“. Zwischen melancholischer Ballade, inklusive Piano und einem zugleich kryptischen wie nachvollziehbaren Text, der von sporadisch-ruppigen Ausbrüchen, bestens in Szene gesetzt wird, malt die Band bedrückende Bilder einer inneren Ausweglosigkeit, die wie ein Stein im Magen liegt. Das „Hexenhaus“ kriecht in ähnlich melancholischem Fahrwasser daher, wird stimmlich aber in ein brutaleres Gewand gekleidet, was jedoch nichts an der beklemmenden Stimmung des Songs ändert. „Silver Surfer“ wartet dann mit einem Breitwandrefrain par excellence auf, der von den langsam ansteigenden Strophen passend kontrastiert wird. Am Ende überrascht „Loreley X2p1“ mit fast Melodic-Death metallischen Vibes. Aufmerksame Fans werden außerdem die Querverweise und Rückbezüge auf den Song „Loreley“ von der „Fauler Zauber Dunkelherz“-EP aus dem Jahr 2007 (auch zu finden in der „Retrospektive“ Box von 2021) erkennen. In etwas mehr als sieben Minuten zünden Callejon hier ein abschließendes Feuerwerk zwischen Härte und Eingängigkeit, das „Eternia“ würdig beschließt.
10. Evergrey – A Heartless Portrait (The Orphean Testament)

Das herzlose Portrait einer Band klingt sicherlich anders. Ganz im Gegenteil verbinden Evergrey auf ihrem mittlerweile dreizehnten Album kopflastige Arrangements mit einer Emotionalität, die den Hörer tief zu berühren vermag. Das liegt natürlich wieder vordergründig am mitreißenden Gesang von Frontmann Tom S. Englund, der noch dazu einmal mehr fantastische Texte aus der Feder zaubert. Aber Stimme und Aussage ergeben noch lange kein Meisterwerk. Ein solches entsteht vielmehr aus der Symbiose vieler kleiner Einzelteile, die am Ende ein beeindruckendes Ganzes ergeben. Im Fall von „A Heartless Portrait (The Orphean Testament)“ ist es die Gesamtheit aus Eingängigkeit, die aber nicht kitschig wird, metallischer Härte, die aber Raum für herzerweichende Melodien lässt und dem beeindruckenden Verständnis der Band für in sich geschlossene Songs, die aus den vielen Einzelheiten ein packendes Stück Progressiv-Metal mit Tiefgang macht. Im Grunde tanzen Evergrey hier auf einer feinen Rasierklinge zwischen brettharten Riffs und tonnenschwerem Groove einerseits und hymnenhaften Melodien, die auch mal kräftig auf die Tränendrüse drücken können andererseits. Trotzdem wirkt hier nichts schmalzig oder übertrieben hart. Vielmehr zieht das Album vom ersten Ton an in seinen Bann und erzeugt ein intensives Auf und Ab der Gefühle, wobei letztendlich immer ein Licht am Ende des Tunnels scheint. Diese intensive musikalische Reise wird von intelligent formulierten und sowohl gegenwartsrelevanten als auch emotional nachvollziehbaren Texten veredelt. Angesichts der Klasse dieser Band würde ein einzelner Anspieltipp diesem Werk nicht gerecht werden. Anhören, eintauchen, genießen!
11. (Dolch) – Nacht

Auf „Nacht“ kehren (Dolch) intime Seite mehr nach außen als bisher und wirken gleichzeitig noch entrückter als auf ihrem Debüt. Anstelle von rituellen Doom-Passagen bietet das zweite Album mehr denn je ambientöse Kälte. Die Songs klingen etwas distanzierter als in der Vergangenheit, was u.a. an den präsenteren Synthpop und Darkwave Elementen liegt. Gleichzeitig finden sich mit Nummern wie „Open“ oder dem von minimalistischen Beats getragenen „I Am Ok“ aber auch unwiderstehliche Ohrwürmer die durch Mark und Bein gehen. In Gänze spielt „Nacht“ noch stärker mit Kontrasten was sich in hypnotischen Tracks wie „Mercury“ niederschlägt. Eindringlich aber minimalistisch pulsiert der Bass, wonach der Refrain wie eine Woge aufbraust und am Ende von schleifenden Riffs ausgeleitet wird. Eine ähnliche Dringlichkeit findet sich später auch in „Bird of Prey“ wieder, das wie Schleifpapier an einer unsicheren Seele schabt. Mit dem verruchten „Tonight“ hat sich auch sowas wie ein Hit auf das Album geschlichen, der kaum mehr aus dem Kopf zu bekommen ist. Tatsächlich weiß „Nacht“ aber vor allem in seiner Gesamtheit zu fesseln. Denn vom ersten bis zum letzten Ton vertonen (Dolch) hier eine entrückte und doch emotional aufrüttelnde Reise durch die Nacht. Dass das nicht nur auf den Gegenpart des Tages, sondern vor allem auf die Stimmungen und emotionalen Schwankungen die ein jeder Mensch im Laufe seines Lebens erlebt zu münzen ist, macht „Nacht“ umso wertvoller und nicht nur für verlorene Seelen reizvoll zu entdecken.
12. Black Void – Antithesis

Black Void sind sowas wie der hässliche Stiefbruder von Lars Are Nedlands letztjährigem Projekt White Void und damit der zweite Teil eines spannenden Doppelkonzepts. Denn was letztes Jahr noch verspielte Seventies-Vibes und Prog-Blüten trug, wird hier mitsamt der Wurzel aus dem Erdboden gerissen, nicht ohne aber danach die Schönheit des zerpflückten Klumpen Drecks zu würdigen. „Antithesis“ bietet punkigen Schwarzmetall der hier und da mit der ein- oder anderen Harmonie in eine schnittige Form gegossen wird. Die immer wieder auftauchenden Verweise gen Crust-Punk verstärken die nihilistische Stimmung umso mehr und doch liegt dem Album in Gänze eine gewisse Schönheit zugrunde. Na gut, Titel wie „Reject Everything“ oder das „It’s Not a Surgery, It’s a Knive-Fight“ zeugen jetzt nicht unbedingt von künstlerischem Schöngeist, sondern suggerieren vielmehr die totale Abkehr von Positivität und Friedfertigkeit. Kein Wunder also, dass die Musik angepisst und giftig klingt. Und auch wenn sich in sämtlichen Songs gehöriges potenzial für Schmerz, Ablehnung und Hass findet, sorgen die vielfach cleanen Refrains, gerade auch in der Kombination mit einem gewissen Rock n‘ Roll-Feeling (u.a. „No Right, No Wrong“) für die Sorte Melancholie, die einen wie ein Magenschwinger unvorbereitet und jäh trifft. Gleiches gilt für die Verwendung von Synthesizern, die der gewalttätigen Attitüde des Albums eine gewisse Eleganz verleihen. Gut, die Lupe ist angebracht um diese Qualität zu entdecken, aber es gibt genug andere Momente an denen sich das Metallerherz erfreuen kann. Denn ein Song wie z.B. „Explode Into Nothingness“ ist nicht nur unverschämt eingängig (diese Gitarren!) sondern bündelt die aggressiv-dreckige Antihaltung des Black Metal mit einer Melodik, die sich unverrückbar ins Stammhirn gräbt. Mit „Nihil“ gibt’s den sprichwörtlichen Schlag ins Gesicht, der mit hämischem Grinsen und diebischer Freude ausgeführt wird. In der zweiten Hälfte bekommt der Song aber einen rhythmisch zähen Break verpasst, der Dank der einleitenden Melodien beinahe etwas Schöngeistiges ausstrahlt, bevor es aber soweit ist, kratzen die Musik wieder die Haudrauf-Kurve, die in dem Black n‘ Roll-Kracher „Dadaist Disgust“ (inklusive Gastgesang von Rotting Christs Sakis Tolis) munter fortgeführt wird. Wobei auch hier der melodische Refrain, genauso einprägsam wirkt wie das knackig rausgerotzte Riffing der Strophen. Damit ist „Antithesis“ ein originelles, unkonventionelles Stück Black Metal, das trotz Traditionswahrung eine interessante Duftnote im aufgewühlten Feld der Schwarzwurzelmusik hinterlässt.
13. Hierophant – Death Siege

„Death Siege“ bündelt die stumpfe Härte des Old-School Death Metal mit schwarzmetallischem Wahnsinn wie ihn u.a. Watain in Vollendung zelebrieren. Das ist nicht die einzige Parallele die Hierophant mit den Schweden teilt. Und doch hat das Chaos hier eine (noch) wildere Ausprägung. Der rohe Klang lässt das Album schier vibrieren, während sich die Musik zu einem infernalischen Dauerfeuer entwickeln. Klangliche Schöngeister werden hier definitiv nicht bedient, dafür gibt’s infernalisches Geschrote, das zwischen chaotischem Wahnsinn, bewusst untypischen Melodien und barbarischer Räudigkeit seinen Platz findet. Trotzdem findet sich kompositorische Genialität unter dem schwarzen Schlick vergraben. Diese zeigen sich aber erst nach und nach und es bedarf immer das Gesamtbild im Auge zu behalten. Dann überzeugt nicht nur der ein- oder andere explosive Einschub zwischen dem Gemetzel, wer hinhört wird auch interessante, weil völlig gegenläufige und untypische Gitarrenmotive (Melodien ist in diesem Fall ein großes Wort) finden, die einem schier die Haut abziehen. Hier werden die Eingeweide nach schwarzer Herzenslust zerwühlt. Und doch finden sich in dem organisch produzierten Chaos derart viele geniale Momente, die immer wieder zum hinhören zwingen. Damit bietet „Death Siege“ chaotische Spannung auf höchstem Niveau und ist ein Muss wenn einem der Sinn ein bisschen nach (musikalischer) Gewalt steht.
14. Umbra Conscientia – Nigredine Mundi

Das Konzept von unterschiedlicher Wahrnehmung und der Dualität der Dinge ist für sich genommen schon eine spannende Sache, dass sich aus dieser, doch sehr universellen Thematik auch finstere Gourmetmusik fabrizieren lässt, zeigen Umbra Conscientia auf ihrem Zweitwerk „Nigredine Mundi“. Ihr Black Metal klingt finster wie selten was, schneidet sich mit allerlei fiesen Riff-Orgien tief ins Fleisch und wechselt immer wieder zwischen punkigem Getrümmer und finsterem Walzenmodus, der wie schwarzer Schlick alles unter sich begräbt. Gleichzeitig sorgen gewisse Disharmonien und sägende Leads dafür, dass sich die Musik nachhaltig im Gehörgang festbeißt. Damit vermählen die Musiker einerseits Räudigkeit und musikalische Finsternis mit einem doch sehr durchdachten Ansatz. Ein Vorteil ist auch die Länge des Albums. Denn obwohl nach einer halben Stunde schon wieder Schluss ist, packt „Nigredine Mundi“ vom ersten Ton an wie ein tollwütiger Hund zu, beutelt und reißt den Hörer in seiner vollkommenen Schönheitsverweigerung mit und überlässt ihn schließlich zerschunden und emotional aufgerieben sich selbst. Trotzdem findet sich in den Details ein Abwechslungsreichtum und eine musikalische Vielfalt, dass es eine Freude ist. Klar ist das gewalttätig, verkommen und emotional zerreibend, aber das muss Black Metal auch sein. Dass Umbra Conscientia aus dieser Tradition kein bisschen auswimpen und doch eigenständig klingen, macht ihre Musik nur noch spannender.
15. The Spirit – Of Clarity and Galactic Structures

Mit ihrem dritten Album lösen sich The Spirit vom bisher recht sklavisch eingehaltenen Standing als legitime Dissection-Nachfolger und führen ihren melodischen Schwarzmetall in deutlich pfiffigere und progressivere Sphären. Zwar ändert sich kaum was an der düsteren Atmosphäre der Musik, aber der Einfluss von Künstlern wie Chuck Schuldiner von Death wird doch viel deutlicher nach außen gekehrt als noch in der Vergangenheit. Nachzuhören u.a. in „The Climax of Dejection“. Der Clou der Herren ist die stets vorhandene Eingängigkeit. Soll heißen: Egal wie krumm die Takte sind, egal wie schnell der Rhythmus wechselt, die Musik spricht, u.a. dank der melodischen Gitarrenarbeit, immer noch zuerst das Herz und dann das Hirn an. Auffällig ist aber doch, dass das Album noch kälter als seine Vorgänger klingt. Aber das macht angesichts des Genres und auch der Thematik durchaus Sinn und Songs wie „Repression“ schleichen sich nach und nach ins musikalische Langzeitgedächtnis, obwohl sie kalt und technisch klingen. Eine Nummer wie „Celestial Fire“ bündelt dann sogar beide Pole dieses Albums: Kalt und technisch brillant einerseits, ist der Refrain andererseits sofort Stammgast im Ohr und das erwähnte Feuer lodert hell und drängend. Ein weiteres Kunststück vollziehen The Spirit damit, dass sie nahezu jeden Song mit einem beinahe ausnahmslos zünden Refrain versehen, egal wie technisch-kalt die Strophen sein mögen, spätestens beim Refrain wird der Hörer wieder eingefangen. Natürlich wollen die Songs en gros erstmal erfasst werden. Denn wirklich straight klingt hier nichts. Aber das verleiht dem Material eine ganz eigene Finsternis, die vom eklektischen, und (nicht nur) elektronisch verspielten Finale „Laniakea“ mit Nachdruck in Szene gesetzt wird. Angesichts der noch relativ jungen Diskografie dieser Band, stellt sich die Frage in welche Sphären das Duo in Zukunft eintauchen wird.
16. Slipknot – The end, so far

Es ist doch interessant, dass eine Band, die seit ihren Anfängen dafür bekannt ist innerhalb eines gewissen Rahmens zu experimentieren, mit ihrem neuen Album immer wieder Kontroversen auslöst. Klar, Slipknot sind mittlerweile Weltstars, aber gerade in einer solchen Position ist es umso interessanter wenn die Musiker nicht stur „Dienst nach Vorschrift“ abliefern, sondern im Rahmen ihrer Möglichkeiten stets neues wagen. Diesem Motto folgend stößt der ruhige, beinahe jazzig (der Bass) wirkende Opener „Adderall“ den ein- oder anderen Die-Hard Fan sicher erst mal vor den Kopf. „The Dying Song (Time to Sing)“ knüppelt danach aber in unverkennbarer Bandmanier drauflos und zündet, auch aufgrund des erzeugten Kontrasts noch heftiger. Das tendenziell chaotisch veranlagte „The Chapeltown Rag“ schlägt sogar eine Brücke zu den wirklich wilden Anfangstagen der Iowaner. Das Chaos wird aber stets effektiv gebündelt, egal ob sich Sid Wilson mit Scratches austobt, oder ob das Riffing der Strophen von krachenden Drums voran geprügelt wird, es läuft immer auf ein bestimmtes Ziel hinaus. Dass Corey Taylor immer noch einer der besten Frontmänner im gegenwärtigen, metallischen Kosmos ist zeigt er u.a. eindrücklich in der schaurig-schönen semi-Ballade „Yen“, bevor er im verstörenden hart/zart Ohrwurm „Hivemind“ seine volle Stimmgewalt ausreizt. Die Strophen hauen derbe aufs Fressbrett und führen mit den bandtypischen Extremen gezielt auf den melodischen Refrain hin. Eine Nummer wie „Medicine for the Dead“ könnte, für sich alleine stehend, sicher etwas belanglos wirken. Das große ABER in diesem Fall ist, dass die unterschwellige Zerrissenheit, das auf und ab zwischen Melodie zu Knüppel-Groove und teils schräg surrenden Leads, sowie Coreys aufbäumenden Screams im Albumkontext eben auch für Spannung sorgt. „Acidic“ klingt dagegen nach vertontem LSD-Trip mit dessen Hilfe der Versuch gestartet wird eine persönliche Krise zu bewältigen. Musikalisch ergibt sich dadurch eine reizvolle Mischung aus akustischer Psychose und finsterem Blues mit hartmetallischer Legierung. „H377“ bietet dagegen den bandtypischen Wahnsinn zwischen Krawall, schrägen Melodien, die einem das Fleisch von den Knochen ziehen und einer doch unverkennbaren Ohrwurmcharakteristik, für die sich besonders die Riffs verantwortlich zeigen. Das ebnet den Weg für „De Sade“, eine gesangliche Glanzleistung von Corey Taylor. Hin und wieder schimmern grungige Vibes hervor, werden aber doch in das Slipknot-typische Gewand gekleidet. Das gilt insofern auch für „Finale“, als dass die Nummer wieder in episch rockende Gefilde, inklusive Chören führt. Nochmal: Coreys Stimme ist dermaßen auf der Höhe, dass sie sofort den Fokus auf sich zieht, aber auch die beklemmende, wenn auch nicht mehr ganz so düstere Atmosphäre gefällt und spannt gewissermaßen den Bogen zum Opener, womit sich „The End, So Far“ als rundes und gleichermaßen reflektiertes wie hungriges Album herausstellt. Mal abwarten was Slipknot in Zukunft anstellen. Dass mit ihnen immer noch zu rechnen ist, haben sie dieses Jahr auf jeden Fall bewiesen.
17. Soilwork – Övergivenheten

Obwohl sich Soilwork auf „Övergivenheten“ so zugänglich wie nie präsentieren, braucht das Album doch einige Zeit um zu zünden. Liegt es an der langen Spielzeit? Eigentlich kaum vorstellbar bei der Band, die (nicht nur) mit einem Melodic-Death Metal Doppelalbum („The Living Infinite“ von 2013) Pionierarbeit geleistet hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Schweden die Grenzen ihres Sounds so weit wie nie zuvor ausloten. Noch nie klang ein Soilwork-Album so unverschämt eingängig und war doch gespickt mit derart brutalen Ausreißern, wie sie lange nicht mehr zu hören waren. Eine Nummer wie „Valley of Gloom“ könnte z.B. eins zu eins auf einem The Night Flight Orchestra-Album stehen (bekanntlich das andere Standbein von Björn „Speed“ Strid), während „It is in your Darkness“ trotz melodischem Refrain, als knüppelharter Brecher daherkommt. Die größte Leistung im Zuge von „Övergivenheten“ ist aber die Tatsache, dass ausnahmslos jedes Stück zündet. Auch wenn der Funke bei mancher Nummer nicht sofort (vielleicht erst beim zweiten oder dritten Durchlauf) überspringt, ist hier alles an seinem richtigen Platz und jedes Detail greift so geschmeidig ineinander, dass einfach nichts in Frage gestellt werden kann. Die Musik packt mit jedem Durchlauf mehr, entwickelt eine stetig wachsende Dynamik und weiß über die Spielzeit von etwas mehr als fünfundsechzig Minuten anhaltend zu fesseln. Ohrwürmer der Marke „Death, I Hear You Calling“ oder arhythmische Kracher wie „This Godless Universe“ (was für ein Spannungsbogen!) sind nur zwei Beispiele von vielen. Denn tatsächlich hat „Övergivenheten“ (gerade wenn man dem Album etwas Zeit zur Entwicklung lässt) keinen einzigen Schwachpunkt, tönt stets unvorhersehbar und beackert diverse Genres scheinbar mühelos und mit solcher Hingabe, dass unterm Strich festgehalten werden muss: Soilwork sind Meister ihres Fachs, kompositorisch nahezu unangreifbar und werden mit jedem Album mutiger und aufregender.
18. Architects – The Classic Symptoms Of A Broken Spirit

Im Grunde macht „The Classic Symptoms Of A Broken Spirit“ genau da weiter wo der Vorgänger „For Those That Wish To Exist“ aufgehört hat. Die Songs klingen dabei aber ein Stück weit fokussierter, es wirkt so als ob die Architects sich in ihrer neuen Soundausrichtung vollends gefunden haben. Die Härte und Brutalität der Vergangenheit ist vollends einer kühlen und deutlich melodischeren Ausrichtung gewichen. Das heißt aber nicht, dass die Musik nicht eine gewisse Heavyness ausstrahlen würde. Die Schwere kommt aber eher durch die Hintertür, gräbt die Seele nach und nach um, anstatt ein direkter Magenschwinger zu sein. Entsprechend dem Albumtitel zieht sich eine bedrückende, beinahe pessimistische Grundatmosphäre durch das komplette Album, wobei die Band trotzdem nicht mit Ohrwurm-Hooks und großer Inszenierung geizt. Stücke wie der Opener „Deep Fake“ schleichen sich zügig ins Musikgedächtnis und beziehen dort ihre Zimmer. Kritiker könnte natürlich bemängeln, dass die Architects sämtliche Wildheit der Anfangstage zugunsten einer glatteren Inszenierung aufgegeben hätten, aber Stillstand ist bekanntlich des Künstlers Tod und musikalisch bleibt die Band nach wie vor wertvoll. Denn Ohrwürmer wie „Tear Gas“, das treibende Melodiespiel in „Doomscrolling“ oder das unterkühlt stampfende „Living is killing us“ zünden ohne Umschweife. Die eine oder andere musikalische Klatsche gibt’s aber doch, oder wenigstens den Anflug davon. Denn „When we were young“ ist zwar mit einer Zuckerwatte-Hookline gesegnet, haut in den Strophen aber energisch um sich und weckt so die eine oder andere Erinnerung an alte Bandtage. Auch „A New Moral Low Ground“ zitiert immer mal die eigene Vergangenheit und verbindet filigrane Melodik mit der stampfenden Energie, welche die Architects immer ein ein Stück weit ausgezeichnet hat. Dass man sich einen DER Ohrwürmer des Albums außerdem fast bis ganz zum Schluss aufspart ist nicht nur in puncto Albumdramatik clever, denn „All the Love in the World“ ist hinten raus nochmal ein fantastisches Sahnewerk zwischen großer Inszenierung und packender Musik. Dass ausgerechnet das finale „Be very afraid“ dann mit am härtesten losprescht, verleiht „The Classic Symptoms Of A Broken Spirit“ eine stimmige Klammer, die sich aber vielleicht nicht sofort erschließt.
19. Blind Guardian – The God Machine

Es ist doch sehr interessant wie sich Fantasie und Realität an manchen Punkten überschneiden. Im Kontext des neuen Blind Guardian Albums zeichnen der Titel, die Cyberpunk-Storyline des fantastischen Artworks und vor allem die Texte zwar zum Großteil das Bild einer Dystopie, zeigen aber auch ein realitätsnahes Abbild einer zerbröckelnden Gesellschaft. Das beginnt mit der zutiefst menschlichen Hoffnung, dass eine wie auch immer geartete Führung das Leben in geordnete und vermeintlich lebenswerte Bahnen lenken könnte („Deliver Us From Evil“), geht soweit, dass purer Egoismus zur staatlichen Gottheit verklärt wird („Secrets Of The American Gods“), bevor „Life Beyond The Spheres“ von der Gewissheit nicht irdischen Lebens erzählt. Im Grunde könnte „The God Machine“ als Interpretation der Geschichte unserer sog. Zivilisation durchgehen. Natürlich sind die Texte immer noch in gewohnt fantastischem Stil gehalten der reichlich Raum für Interpretationen lässt, aber Songs wie „Architects of Doom“ könnten doch sehr treffend als Beschreibung einer möglichen Intention hinter den Argumenten verstanden werden, welche die letzten Jahre von Seiten sog. Regierungen zur gesellschaftlichen Vollkatastrophe gemacht haben. Da passt es auch gut ins Bild, dass Blind Guardian auf „The God Machine“ wieder um einiges härter zu Werke gehen und den Bombast merklich zurückgefahren haben. Insofern ist dieses Album auch als eine Reaktion auf den 2015er Vorgänger „Beyond The Red Mirror“ und vor allem das Orchesterwerk „Legacy Of The Dark Lands“ zu werten. Denn was auf diesen beiden Alben jeweils zur Perfektion in jeglicher Hinsicht getrieben wurde (Story, Bombast und die Vermischung von beidem) wurde auf dem aktuellen Werk merklich reduziert (orchestraler Bombast findet sich nur vereinzelt in den neuen Songs), bzw. hat eine andere Ausrichtung bekommen. Inwieweit das als Rückbesinnung oder eigene Neuerfindung gewertet werden kann, darf natürlich diskutiert werden. Fest steht, dass Blind Guardian auf diesem Album in erster Linie vom eigenen Schaffen inspiriert sind und sich trotzdem (oder gerade deswegen) ein Stück weit neu erfunden haben.
20. Belphegor – The Devils

Angesichts dessen, dass Belphegor seit jeher monumentalste Black/Death Metal-Perversion abliefern und man doch stets relativ gut weiß was man von einem neuen Album erwarten kann/darf, ist es doch interessant wie sich an jeder Scheibe der Österreicher immer wieder die Geister scheiden. Dem einen ist das Image zu aufgesetzt, dem anderen ist Helmuths Auftreten zu grotesk, aber wirklich substanzielle Kritik an der Musik findet sich kaum. Wie auch? Die Herren sind seit einer Ewigkeit eine feste Größe in der Szene und variieren ihren Sound stets nur in Nuancen, ohne sich aber zu wiederholen. Das alleine ist angesichts der Beständigkeit der Band schon eine nennenswerte Leistung. „The Devils“ macht dieses Jahr das diabolische Dutzend der Diskografie voll und bietet genau das was man von Belphegor haben will. Vielleicht schlägt das Pendel wieder ein wenig mehr gen Schwarzmetall aus, aber das sind marginale Details. Vielmehr sind es auch diesmal wieder die fiesen Melodien, die Songs wie das rasende „Totentanz-Dance Macabre“ oder auch den erhabenen Black Metal-Schleifer „Glorifizierung des Teufels“ zu eindringlichen Kleinoden extremer Musik machen. Mit hypnotischen Leads und einer fast sakralen Stimmung, bietet „Virtus Asinaria – Prayer“ feierliche Finstermusik, wie sie kaum eindringlicher sein könnte, ehe „Kingdom of Cold Flesh“ in den Knüppelmodus schaltet und dank flirrenden Gitarrenmelodien, eisig-scharfkantigen Screams, tiefen Growls und dem ein- oder anderen choralen Zusatz, als fieser Sturm durch die Ohren pfeift. Auch „Ritus Incendium Diabolus“ hat dieses sakrale Element, wirkt aber noch einen Tick wahnsinniger und fräst sich beständig ins Langzeitgedächtnis. Nachdem „Creature of Fire“ ein andächtiges, aber doch martialisch-gewaltiges Outro abgibt, folgt mit „Blackest Sabbath 1997“ noch ein Bonusschmankerl. Hier wurden „Blutsabbath“ und „Blackest Ecstasy“ vom 1997er Album „Blutsabbath“ als Hybridversion neu eingespielt und schneiden sich als brutal-fieses Finale in die Gehörgänge. Belphegor bleiben sich auch auf Album Nr. zwölf treu und halten eine unheilige, perverse, aber musikalisch über jeden Zweifel erhabene schwarze Messe ab.
Dominik Maier