Wie (zum Glück) üblich, sind zwanzig repräsentative Alben am Jahresende einfach zu wenig, um die Menge an starken Veröffentlichungen im Bereich metallischer Musik ausreichend zu würdigen. Da Listen aber auch nicht ausufern sollen, gibt’s hier wieder einen schmalen Einblick in relevante Alben aus dem Bereich (härterer) Rockmusik, die 2024 das Licht der Welt erblickt haben.
1. Iotunn – Kinship

Iotunn klotzen statt zu kleckern. Das untermauert nicht nur das vierzehn Minuten-Epos „Kinship Elegiac“, welches „Kinship“ vielseitig und verspielt eröffnet. Auch über den weiteren Albumverlauf glänzt die Band mit unvorhersehbarem und vielfältigem Songwriting, wobei sich der Death Metal Anteil in der Musik auf ein Minimum reduziert hat und nur noch in vereinzelten Growls durchschimmert. Stattdessen singt Jón Aldarás klar und voller Inbrunst und erschafft in jedem Song eine plastische Gefühlswelt, die diverse Szenerien vor dem inneren Auge des Hörers aufleben lässt. Für ein cineastisches Erlebnis sind aber auch die Instrumentalisten mitverantwortlich, denn was in Stücken wie „I feel the Night“ oder „The Coming End“ passiert, ist großes Ohrenkino. Detailreiche Gitarrenabfahrten treffen auf abrupte Wendungen. Epischer Heavy Metal geht Hand in Hand mit progressiven Schlenkern und krummen Takten, ohne, dass der Fluss der Musik auch nur eine Sekunde unterbrochen wird. Dass Iotunn es trotzdem verstehen, griffige Ohrwürmer mit Langzeitwirkung zu komponieren, beweist u.a. das treibende „The Coming End“, das mit hypnotischer Gitarrenarbeit gleichsam fasziniert, wie der warm tönende Bass stellvertretend für das lebendige Soundbild des Albums stehen könnte. Die Melancholie einer Ballade wie „Iridescent Way“ drückt dabei ebenso stark auf die Tränendrüse, wie sie Iotunns Songwriting-Fähigkeiten unterstreicht. Hier wird nichts dem Zufall überlassen und doch fließt „Kinship“ mit eleganter Natürlichkeit dahin, weiß durch Details zu fesseln und hält auch nach dem x-ten Durchlauf noch neue Details und emotionale Wendungen bereit. Die beiden Schlusstracks „Earth to Sky“ und „The Anguished Ethereal“ schießen diesbezüglich den Vogel ab und geraten zum emotionalen Parforceritt, der die Skala menschlicher Empfindungen mehrmals auf und ab klettert.
2. Kanonenfieber – Die Urkatastrophe

Kanonenfieber haben mit ihrem Debütalbum „Menschenmühle“ einen beachtlichen Hype erfahren, den es nun (nach diversen EP-Zwischenhappen) mit „Die Urkatastrophe“ zu untermauern gilt. Bei druckvollem Sound überzeugen Mastermind Noise und seine Mannschaft vor allem auch durch die Qualität der Texte, für die ein Hobby-Historiker mitsamt seinem umfangreichen Fundus an Briefen und anderen Zeitzeugen-Dokumenten zu Rate gezogen wurde. Das Ergebnis ist ein mitreißender Hybrid aus melodischem Black- und Death Metal, der trotz aller textlicher Gräuel schmissig komponiert wurde und eingängig ausfällt. Dass die Songs dabei durchweg live-tauglich und (auch dank mitgröl-tauglicher Refrains) hymnisch klingen, steht weniger im Widerspruch zur beklemmenden Thematik, als mancher vielleicht glauben mag. Denn Stücke wie „Waffenbrüder“ transportieren stets ein beklemmendes Gefühl (das u.a. auch von diversen Original-Zitaten und als Zwischenspiele eingefügte, historische Sprachaufnahmen verstärkt wird) zwischen Verlustangst und Heroik, tönen aber trotzdem unnachgiebig und schmissig aus den Boxen. Für die eindringliche Atmosphäre sorgen außerdem historische Gedichtvorträge wie in „Verdun“, das in die ausladende und beklemmende „Ausblutungsschlacht“ mündet. In diesem Finale hinterlassen Neo-Folk-Anleihen und rezitierender Sangescharakter einen gehörigen Kloß im Hals des Hörers, was die musikalische, sowie emotionale Qualität von Kanonenfieber als Band, aber auch von „Die Urkatastrophe“ als Album unterstreicht.
3. Panzerfaust – The Suns Of Perdition IV: To Shadow Zion

Kanadas Panzerfaust gehen in die vierte und finale Runde ihrer Vertonung des globalen Kollapses. „The Suns Of Perdition IV: To Shadow Zion“ bietet einmal mehr trostlose Musik mit Köpfchen und rechnet ein für alle mal mit der Menschheit ab. Dabei erzeugt das Album eine dichte Atmosphäre, die dank der detailreichen Komposition aller Stücke wie ein Mahlstrom sämtliches Licht verschlingt. Neben den einnehmenden Growls, die vorwiegend gebieterisch dröhnen, zermalmen die Grooves mit stoischer Vehemenz jeden Zweifel an der Dringlichkeit, welche die Texte vermitteln. Denn ja, Panzerfaust zelebrieren den menschlichen Verfall, die zunehmende Verrohung und die sprichwörtliche Apokalypse zuvorderst mit Bezug auf weltliche Themen. Ein Stück wie „Occam’s Fucking Razor“ spannt unter dieser Prämisse den Bogen von der Vergangenheit beider Weltkriege bis hin zur Gegenwart, wobei eine Zeile wie „The Somme. Donbas. Stalingrad.“ weniger wertet, als den Bezug zur menschlichen Gräuel generell herauszustellen. Zur Untermauerung dieser textlichen Dringlichkeit schlagen sämtliche Kompositionen irrwitzige Haken, das Schlagzeugspiel setzt Akzente en masse und donnert präzise und effektiv. Die Gitarren schleichen sich mit klammen Melodien in den Kopf des Hörers, spuken dort geisterhaft herum und säbeln subtil und scharfkantig am Nervenkleid, ehe gewaltige Riffberge ihr schroffes Antlitz brachlegen, nur um im nächsten Moment klanggewordenen Irrsinn zu zelebrieren. Die Krönung des Ganzen ist die gebieterisch dröhnende Stimme, die schreit, leidet, aufrüttelt und tollwütig brüllt. Dass nach dem finalen Sirenengeheul die (Emotions-) Welt des Hörers in Schutt und Asche liegt, unterstreicht die destruktive Wirkung der Musik, mit der sich Panzerfaust einmal mehr technisch ausgefeilt und unvorhersehbar zeigen. Zugleich verschlingt die Atmosphäre von „The Suns Of Perdition IV: To Shadow Zion“ alles Licht, lässt am Ende aber doch ein wenig Hoffnung zu. Denn aus der Asche der Vernichtung kann Neues wachsen. Was das für Panzerfaust bedeutet wird die Zukunft zeigen. Ihre Album-Tetralogie „The Suns Of Perdition“ haben sie jedenfalls intensiv und tiefschürfend abgeschlossen.
4. Hauntologist – Hollow

Hauntologist bestehen aus Drummer Darkside (u.a. auch Mgła) und Sänger/Multiinstrumentalist The Fall (u.a. Live-Mitglied von Mgła). Die durchdringende Atmosphäre von „Hollow“ kommt also nicht von ungefähr. Wenngleich das Album weniger direkt auf dem Pfad des Nihilismus wandert, wie es Mgła zuweilen tun. Stattdessen zeichnet sich die Musik durch eine geisterhafte Komponente aus, die Assoziationen zu den neueren Werken von Behemoth hervorruft, was auch an dem Knurren von The Fall liegt. Dass Darksides Schlagzeugspiel der Musik unweigerlich seinen Stempel aufdrückt sollte klar sein. Denn der Mann hat einen sehr speziellen Charakter, der sich vor allem im fantasievollen Einsatz diverser Becken und rhythmischer Fills erkennen lässt. Das macht Stücke wie das progressiv angehauchte „Deathdreamer“ zu spannungsgeladenen Kleinoden düsterer Musik, die von einer schwer fassbaren Atmosphäre leben. Kein Wunder, dass z.B. das Titelstück das Gefühl der titelgebenden Leere, mit schmerzlicher Atmosphäre bei reduzierter Instrumentierung und klarem Gesang auf die Spitze treibt. „Autotomy“ treibt danach Black Metal-Widerhaken in das perforierte Gefühlskleid des Hörers, schlängeln sich die Gitarren doch wie unberechenbare Schatten durch die Ohren, ehe „Gardermoen“ mit klarem Gesang und Post-rockiger Atmosphäre den Soundtrack zum Regenspaziergang durch die eigene Emotionsmüllkippe liefert. Mechanisch hallende Spoken Word Einlagen lassen den melodisch-atmosphärischen Abschluss „Car Kruków“ fast depressiv erscheinen. Gefühle von Einsamkeit und Weltverdruss machen sich breit, was den Titel, der übersetzt in etwa „Rabenhaus“ bedeutet, seltsam passend wirken lässt. Denn so stolz die schwarzen Vögel auch erscheinen, so dröge scheint ihre Präsenz. Was in diesem Fall die mythologische Bedeutung im Zusammenhang mit dem Christentum, oder bestimmtem Hexenglauben unterstreicht, in denen der Rabe auch als Unglücksvogel und Vorbote von Tod und Verderben gesehen wird. Dass diese Interpretation wiederum sehr gut zur pessimistischen Stimmung des Albums, aber auch der lebensfeindlichen Ausrichtung des Black Metal allgemein passt, ist wohl kaum ein Zufall.
5. Einvigi – Monokroma

Sommer, Sonne, Black Metal? Eher nein, denn Einvigi spielen wohl kaum Musik für die warme Jahreszeit. Dennoch klingt „Monokroma“ mitnichten finster oder bösartig. Dass die Finnen auf Genre-Reinheit pfeifen, wird dabei nicht nur im Sonnenschein-Artwork deutlich. Auch die Musik fließt zwischen elegischem Post-Rock, der viel Raum für lichtvolle Gefühle lässt und Black Metal-Stürmen hin und her. Dabei gewinnt das Album vor allem auf der Gefühlsebene zunehmend an Reiz, der dem Cover-Artwork folgend, sowohl positive Glücksmomente zulässt, als auch tränenreiche Täler offenbart. Ein Stück wie „Tumman veden lapsi“ vereint diese scheinbaren Gegensätze u.a. in der Symbiose von klarem Gesang zu Eissturm-Drums, während im nächsten Moment melancholisch verträumte Gitarrenmelodien auf die Tränendrüse drücken. Dass es für das Erlebnis, das die Musik bietet, egal ist, ob der Hörer die finnischen Texte versteht oder nicht, zeugt von der kompositorischen Fähigkeit Einvigis, die sich mit „Monokroma“ alles andere als eintönig geben und stattdessen ein mitreißendes Album präsentieren, das Träumerherzen ebenso anspricht, wie es Schmerz und Gram ob des Lebens selbst als Inspiration in sich trägt.
6. Pøltergeist – Nachtmusik

Pøltergeist wandeln lyrisch auf den Pfaden von Edgar Allen Poe und H.P. Lovecraft und spielen dazu passend Geisterbahn-Rock. Da dieses Genre aber so noch nicht benannt ist, lässt sich die Musik wohl besser als Mix aus düsterem Heavy Metal, Post-Punk und Gothic Rock beschreiben. Deathrock wäre auch eine passende Verschlagwortung für „Nachtmusik“, wobei die Songs durch ihre Detailverliebtheit (nachzuhören u.a. in der Gitarrenarbeit von Stücken wie „Will We Ever Live Again“) ebenso überzeugen, wie sie mit latenter Gruselwald-Stimmung fesseln. Dass sie aber auch anders können, zeigen die Musiker u.a. mit dem verträumten Melancholiker „Walking Alone“, der dank motivierendem Text weniger schwer wiegt als es der Titel suggeriert und wie geschaffen für die düsteren Rock-Diskotheken scheint. Schließlich will der Darkroom mit einsamen Seelen, die ins Vergessen tanzen wollen, gefüllt werden. Eine allgemeine Stärke der Musik ist auch der druckvolle Sound, der allen Instrumenten den nötigen Raum gibt, ohne, dass der treibende Bass in einem Stück wie z.B. „Ethereal Nightmare“ den filigranen Gitarren, oder dem kühl-schmeichelnden Gesang in die Quere kommt. Dass darüber hinaus alle Songs schnell im Kopf bleiben und beinahe sofort zur tanzähnlichen Leibesübung animieren, unterstreicht die Kurzweiligkeit dieser „Nachtmusik“ ebenso, wie es die Langlebigkeit dieses Debüts verstärkt.
7. Black Curse – Burning in Celestial Poison

Black Curse lassen ihren pestverseuchten Black Metal/Death Metal-Hybrid ein weiteres Mal auf die Welt los. Dabei hat sich an der Grundausrichtung des Sounds kaum etwas verändert, denn „Burning in Celestial Poison“ klingt bestialisch wie sein Vorgänger und auch die übergeordnete Manie ist nicht aus der Musik verschwunden. Tobende Riffs überschlagen sich zu Polter-Drums, die an eine Bestie bei der Hatz erinnern, während das entmenschlichte Gebrüll zwischen Besessenheit und tollwütigem Geschrei hin- und herpendelt. Hinzu kommen Momente, in denen die Musiker die Handbremse ziehen, wodurch eine beinahe schmerzhafte Spannung entsteht, die etwas von einer Hand in einem Getriebe hat. Unerbittlich gräbt sich das Metall ins Fleisch. Knochen splittern, Blut spritzt und trotz all dem Schmerz geht von der Szenerie eine groteske Faszination aus. Selbiges gilt für die Musik, die kaum Zeit zum verschnaufen lässt, sich stets im eigenen Wahnsinn überschlägt und doch mit einer undurchsichtigen, infernalischen Klangkulisse punktet. Damit wirkt „Burning in Celestial Poison“ sowohl kathartisch, als auch verstörend majestätisch und ist, wie sein Vorgänger, ein Extrem Metal-Filetstück.
8. The Omega Swarm – Crimson Demise

Sulphur Aeons T. widmet sich auf dem Debüt seines Zweitprojekts The Omega Swarm eher weltlichem Horror, denn Lovecraft zu hofieren und liefert mit „Crimson Demise“ einen atmosphärischen Brocken zwischen Black- und Death Metal, der mitunter von orchestralen Elementen eine Menge Drama verpasst bekommt. Dadurch wirkt die Musik cineastisch, was die Texte über den Niedergang der Menschheit, bzw. die menschengemachte Apokalypse zusätzlich verstärkt. Dass T. nicht aus seiner Haut kann, untermauern u.a. die detailverliebten Kompositionen, die vor allem im Gitarrenbereich stets aufhorchen lassen, aber auch mitreißende Refrains (z.B. in „Lethal Increase“) nicht missen lassen. Dass der Sound mitunter klinisch-kalt tönt, ist für die Wirkung der Musik weniger schlimm als mancher glauben mag. Denn apokalyptische Hymnen über Selbstzerstörung und Niedergang der Menschheit, wie z.B. das episch orchestrierte „Lethal Increase“ entfalten eine beklemmende Atmosphäre, dank der einem diverse Zeilen und Refrains eine ganze Zeit lang im Kopf herumspuken. Dass sämtliche Stücke darüber hinaus mit Tempovariationen und diversen, kleinteiligen Kniffen (wie z.B. dem Klargesang im berserkenden „Entity Destroyer“) aufhorchen lassen, untermauert die Tatsache, dass T. ein fähiger Songwriter ist, der es stets versteht talentierte Musiker um sich zu scharen um seine künstlerischen Visionen zum mitreißenden Erlebnis zu machen.
9. The Spirit – Songs Against Humanity

The Spirit verlagern die Astralreisen der vorherigen Alben mit „Songs Against Humanity“ zurück auf die Erde, was nicht nur die Farbgebung des famosen Eliran Kantor-Artworks unterstreicht. Musikalisch geht’s auch wieder eine Ecke geradliniger zu, wobei die Melange aus melodischem Black- und Death Metal alles andere als stumpf klingt. In Sachen Gitarrenriffing haben die Herren sogar an Effektivität zugelegt und erschaffen in Stücken wie „Room 101“, oder dem messerscharfen „Spectres Of Terror“ eine unheilvolle Atmosphäre, bei der manch rhythmischer Schlenker wie aus einem dichten Nebel heraus nach der Kehle des Hörers greift. Diese Unvorhersehbarkeit hindert The Spirit aber nicht daran einen majestätischen Schleifer wie „Death is my Salvation“ von der Leine zu lassen. Nach einem behäbigen Einstieg fesselt der Song mit detailreicher Gitarrenarbeit, deren Höhepunkt ein ergreifendes Solo ist, ohne die finstere Atmosphäre zu verleumden, dass die Bridge, bzw. der Refrain noch dazu schmissig, fast heroisch herausgeschrien wird, birgt zusätzliches Potenzial für großes Ohrenkino. Gleiches gilt für „Nothingness Forever“, dass mit dringlichen Melodien und hymnischem Charakter nochmal alle Facetten von Dunkelheit, Nihilismus und zielgerichteter Angriffslust bündelt, ehe „Orbiting Sol VI“ als verspieltes und atmosphärisches Instrumental zum Schluss mehr Licht zulässt, als es der allgemeine Fatalismus, den der Albumtitel ausstrahlt, vielleicht vermuten lässt. Damit birgt dieses Ende aber auch Zeit zur Reflektion des Menschen, der Menschheit, aber auch der eigenen Existenz.
10. Darkest Hour – Perpetual | Terminal

Eingefasst in die dramaturgische Klammer des eröffnenden Titelstücks und des Schlusssongs „Goddess of War, Give Me Something To Die For“, die beide mit Schlachtenhymnen-Refrains der Extraklasse gesegnet sind, toben sich Darkest Hour auf „Perpetual | Terminal“ nach Herzenslust aus und betreiben damit gewissermaßen Genre-Konsolidierung. Denn als Metalcore/Melodic Death Metal-Keimträger (die Band wurde vor knapp dreißig Jahren gegründet) schnüren die Amis mit ihrem zehnten Album ein durchschlagendes Songpaket, das u.a. mit einem packenden Spannungsbogen aufwartet. Dass dabei jeder Song wenigstens einen griffigen, wenn nicht ohrwurmtauglichen Refrain vorweisen kann, ist nicht die einzige Stärke der Musik. Vielmehr gewinnt „Perpetual | Terminal“ dank schlüssiger Dramaturgie immer mehr an Reiz. Während das eröffnende Titelstück melodischen Todesblei mit dem erwähnten Hymnenpotenzial vermählt, thrasht „Societal Bile“ heftig drauflos, ehe „A Prayer to the Holy Death“ mit einem Weltklasse-Refrain und melodischer Gitarrenarbeit, gewissermaßen Genre-Wurzelbehandlung betreibt. Dabei wirkt das Album als Ganzes erstaunlich vielschichtig, lässt in verspielten Nummern wie „The Nihilist Undone“ aber zu keiner Zeit die großen Refrains missen. Mit dem atmosphärischen Schleifer „One with the Void“ tauchen Darkest Hour in emotionales Brachland ab, aus dem die Hardcore-Knüppelei „Love is Fear“ aber zügig wieder austritt. „Mausoleum“ macht als Power-Ballade eine sehr gute Figur, wirkt stets angespannt und explodiert in jedem Refrain aus mehrstimmigem Gesang heraus. Vor dem eingangs erwähnten Finalhammer knüppelt „My Only Regret“ mit leichter Punk-Tendenz drauflos, wartet gegen Ende aber auch mit einem Gitarrensolo der Extraklasse auf, das den Weg für abschließende Kriegsgöttin ebnet und ein abwechslungsreiches Album stilvoll beendet.
11. Bonjour Tristesse – The World Without Us

Als Finale der mit dem Vorgängeralbum begonnenen Duologie geht „The World Without Us“ den eingeschlagenen Weg weiter. Dabei richtet Mastermind Nathanael den Blick aber verstärkt auf den nihilistischen Aspekt des Daseins und stellt, dem Titel gemäß, Fragen nach der Relevanz des Lebens per se. Dementsprechend klingt dieses Album depressiv und vermag den Hörer regelrecht niederzuschmettern. Dass das Titelstück als überwiegend schleppender Trauerkloß seinem Namen alle Ehre macht, verwundert weniger, wie die Tatsache, dass das Album, neben gehöriger thematischer, wie auch emotionaler Tiefe, stets unvorhersehbar bleibt. Das liegt auch daran, dass Bonjour Tristesse keine plakative Todessehnsucht propagieren, sondern eher verkappte Philosophen abgeben und z.B. auf Schoppenhauers Erkenntnispfaden wandeln, indem sie feststellen, dass die Menschenschöpfung und ihre Evolution ein Fehler war, der von der Natur zwangsläufig korrigiert werden wird. Die Melancholie von Stücken wie „Against the Grain“ birgt jedoch auch eine gewisse Schönheit. Nicht nur musikalisch, sondern bildlich, denn gegen den Strom zu schwimmen ist in der Regel einer Kämpferhaltung, oder wenigstens einer gewissen Selbsterkenntnis geschuldet. Im Falle von Bonjour Tristesse mündet dieses Selbstbewusstsein in der Erkenntnis, dass die Welt ohne uns besser dran ist. Dass in diesem Zusammenhang der dezidiert auf den Menschen gemünzte Abschluss „The Great Catastrophe“, trotz der scharf angesetzten Emotionsskalpierung einen gewissen Stolz nicht leugnet, zeugt ebenso von künstlerischer Reife, wie es den thematischen Ernst und die Gegenwartsrelevanz dieser Band untermauert.
12. The Crown – Crown Of Thorns

Auch wenn der Albumtitel „Crown Of Thorns“ als Reminiszenz an den ursprünglichen Bandnamen von The Crown durchgeht (die Schweden gründeten sich unter jenem Banner 1990 und veröffentlichten zwei Alben, ehe 1998 die Umbenennung stattfand), ist das Album keine bloße Nostalgie-Veranstaltung. Stattdessen rast der Death/Thrash-D-Zug überwiegend fix voran, lässt aber vermehrt auch Bremsklötze zu. So wildert „The Night Is Now“ im Midtempo-Bereich, wobei die Wucht der Riffs und Grooves stets aggressiv und bissig klingt. Die dicken Bretter bohren The Crown aber meist im Bereich aggressiver Schnellangriffe. Allen voran „God-King“ und der Crust-Knüppler „The Agitator“ zwirbeln die Nackenwirbel gehörig durcheinander. „Where Nightmare Belong“ rast zunächst etwas chaotisch voran, setzt sich im weiteren Verlauf aber Dank dem hymnischen Refrain und einer unterschwelligen Gothic-Attitüde (verstärkt durch weiblichen Gesang am Ende) ähnlich markant im Ohr fest wie das finale Schlachtenmonster „The Storm That Comes“. Hier treffen epische Gitarrenmelodien auf getragene Grooves und eine sinistre Atmosphäre, die den hymnischen Gitarren nie in die Quere kommt. Mit drei Bonustracks bietet die Digipack Version des Albums außerdem einen echten Mehrwert, denn sowohl der scharfkantige Death Metal meets Rock n‘ Roll in „Eternal Infernal“, als auch der groovige Nackenbrecher „No Fuel For God“ überzeugen vom Fleck weg. Der rasante Abschlusshammer „Mind Collapse“ prügelt letztendlich nochmal alle Zweifel an den Qualitäten dieser Band nieder und setzt als Flitzefinger-Death/Thrash-Vorschlaghammer einen kurzweiligen Schlusspunkt.
13. Devil’s Hour – Apocalyptic Drunken Bastards

Dass sich Metal (in all seinen Subausprägungen) und Bier gut ergänzen ist eigentlich kein Geheimnis. Die Hessen-Rabauken von Devil’s Hour wollen’s aber genau wissen und machen aus ihrer Kampftrinker meets Straßenköter-Attitüde keinen Hehl. Rotzpunk, Black Metal und Rock n‘ Roll heißen die Grundpfeiler des Sounds, der mit dem vielsagenden Albumtitel „Apocalyptic Drunken Bastards“ kaum treffender beschrieben werden könnte. Dabei sprudeln die Musiker vor Spielfreude und reißen den Hörer mit ungestümer Energie in einen vertonten Alkoholrausch, bei dem schon mal die eine oder andere Bierflasche durchs heimische Zimmer fliegen kann. Gleichzeitig eignet sich der ungestüme Sound hervorragend um sich den eventuell nahenden Kater am Morgen nach der Party-Eskalation aus dem Leib zu prügeln. Ein Titel wie „Blood, Sweat & Beers“ ist demnach auch kein plakatives Säuferbekenntnis, sondern eher die kompromisslose Umschreibung eines Rock n‘ Roll-Lifestyles, der sich seine Stielaugen zwischen Punk und Black Metal schief schielt. Mit einer halben Stunde Spielzeit gerät das Album zudem angenehm kurzweilig und regt die Nackenmuskeln zum Dauertraining an. Gesoffen wird nach dem Training! Dann aber bitte ein Schwarzbier. Die Welt geht schließlich mit Stil zugrunde!
14. Judas Priest – Invincible Shield

Der Rückenwind des 2018er Erfolgsalbums „Firepower“ beflügelte Judas Priest offenbar dermaßen, dass sie mit „Invincible Shield“ gute sechs Jahre später nochmal einen drauf setzen. Dabei begnügen sich die Priester nicht mit bloßen Selbstzitaten, sondern klingen inspiriert und variabel wie lange nicht. Dass dabei vor allem Rob Halford erneut eine Glanzleistung abliefert, ist ebenso wenig selbstverständlich, wie die immer noch anhaltende Wirkung der Energiespritze in Persona Richie Faulkner. Der Titeltrack, oder auch die eröffnende „Panic Attack“ klingen zwar energisch, verlieren sich aber kaum in Formelhaftigkeit, sondern wissen durch komplexes Gitarrenspiel und diverse Wechsel in der Rhythmusmotivik zu fesseln. „Devil in Disguise“ und „Gates of Hell“ treten dagegen auf die Bremse und vermählen hochmelodische Gitarrensoli mit unerwarteter Harmonie- und Melodieführung. Dass besonders letztere Nummer mit einem echten Knaller-Refrain glänzt, ist außerdem ein Umstand, der sich auf die eine oder andere Art durch das ganze Album zieht. Judas Priest schreiben weniger offensichtliche Hits, schaffen es aber den Hörer mit jedem Song zu packen und mitzureißen. Ganz groß in diesem Zusammenhang: „As God is my Witness“, das ebenso wie das wenig später folgende „Sons of Thunder“ trotzige Härte mit Hymnencharakter verbindet und vor allem dank Rob Halfords Gesang vom Fleck weg mitreißt. Ähnliches gilt für den Stampfer „Trial By Fire“, der mit einem wahren Gänsehaut-Refrain aufwartet. „Escape from Reality“ kommt ähnlich schleppend daher und zitiert an mancher Stelle gar ungewöhnliche Stilelemente aus der Vergangenheit (wie z.B. einen Verzerr-Effekt auf Rob Halfords Stimme der an an „Jugulator“ gemahnt). Judas Priest klingen aber stets nach sich selbst und unterstreichen einmal mehr ihre Fähigkeit zur Heavy Metal-Hymne: „Giants in the Sky“ ist zwar weniger pathosschwanger als manch musikalischer Schlussstein der Vergangenheit, geht aber als getragene Hymne mit ergreifendem Gitarren-Intermezzo gegen Ende locker als eine der stärksten Nummern der (jüngeren) Bandvergangenheit übers Ziel. Die Hardcover-Bonustracks „Fight Of Your Live“, „Vicious Circle“ und „The Lodger“ halten das Niveau des Basisalbums locker und glänzen u.a. durch eingängige Gitarren-Harmonien („Vicious Circle“), oder eine interessante, weil wehmütig-balladekse Stimmung, die sich um diverse Rachegedanken dreht („The Lodger“).
Fazit: „Invincible Shield“ zeigt Judas Priest voll im kreativen Saft und die Band beweist auch fünfzig Jahre nach ihrem Albumeinstand, dass sie die Gratwanderung zwischen kompositorischem Mut zum Risiko und Traditionsbewusstsein mit Bravour beherrscht. Damit halten die Priester den Schild des Heavy Metal wirkungsvoll hoch!
15. Emil Bulls – Love Will Fix It

„Love Will Fix It“. Die Liebe richtet alles. Ein schöner Titel mit dem die Emil Bulls Das Musikjahr 2024 eingeläutet haben. Dass ihnen dabei ein Dutzend Hits zwischen hart groovendem Modern Metal (u.a. „Happy Birthday You Are Dead To Me“) und radiotauglichem Pop-Ohrwurm (das finale „Together“) gelingen untermauert den Crossover-Faktor, der bei den Münchnern seit jeher Gang und Gäbe ist. Fixpunkt ist dabei einmal mehr der charakteristische Gesang von Christoph von Freydorf, der stets die passende Mitte zwischen Aggression und Melodie findet, ohne damit aufgesetzt zu wirken. Hinzu kommt der Umstand, dass jeder Song mit einem Ohrwurm-Refrain gesegnet ist, wodurch die diversen Stimmungen der Stücke allesamt nahbar an den Hörer getragen werden. Egal ob die Emil Bulls mit „Levitate“ auch tempotechnisch abheben, oder ob „Whirlwind Of Doom“ sowohl mit harter Gitarrenarbeit in den Strophen begeistert, als auch im Refrain beinahe an ein Kinderlied erinnert, die Musiker untermauern mit jedem Song ihre Fähigkeit wandelbare Songwriter zu sein und dabei trotzdem ein Händchen für Hits im Grenzbereich zwischen Metal und Pop zu haben. Dass die Musik dabei niemals aufgesetzt wirkt, vielmehr stets ehrliche Emotionen vermittelt macht „Love Will Fix It“ nicht nur ob seiner textlichen Botschaft zu einem Fanal für Zusammenhalt, sondern dank der Musik auch zu einem Album, das die Emil Bulls einmal mehr als feste Größe im Bereich des Modern Metal präsentiert.
16. Linkin Park – From Zero

Natürlich fangen Linkin Park mit „From Zero“ nicht komplett neu bei Null an. Aber nach sieben Jahren Funkstille seit Chester Benningtons Tod, ist eine gewisse Spannung bzw. Erwartungshaltung an dieses Album unvermeidbar. Mit Sängerin Emily Armstrong haben Mike Shinoda und Co. dabei einen Glücksgriff hingelegt. Denn die Dame bringt einen neuen Charakter in die Musik von Linkin Park ein, der das Potenzial birgt, sowohl alt-Fans zufrieden zu stellen, als auch jene Hörer anzusprechen, die bisher wenig mit dem Pop/Rap/Rock-Hybrid der Amis anfangen konnten. Das liegt nicht zuletzt auch an der musikalischen Vielseitigkeit die Linkin Park anno 2024 an den Tag legen. Während nahezu jeder Song, bzw. jeder Refrain das Potenzial hat Stammgast im Musikohr zu werden, finden sich neben radiotauglichen Pop-Rock Stücken wie „Over Each Other“ oder dem instrumental reduzierten „Stained“ auch stoische Brecher wie „Casualty“ bei dem Emily Armstrong mit Reibeisen-Geschrei und drückender Aggression glänzt. Aber auch der klassische Crossover-Sound, der Linkin Park groß gemacht hat, ist nicht verschwunden. „Heavy Is The Crown“ oder „Two Faced“ transportieren den klassischen Linkin Park-Sound in die Jetzt-Zeit und reißen nicht nur dank der superben Stimme von Emily Armstrong mit. Mit „Good Things Go“ gelingt der Band außerdem eine erfreulich unkitschige Herzschmerz-Ballade, die „From Zero“ zwar als Ohrwurm beschließt, aber doch das Potenzial mitbringt eine Zeit lang schwer im Magen zu liegen und sei es nur wegen der einfühlsamen Stimmkombination von Mike und Emily.
Fazit: Comeback geglückt!
17. Nightwish – Yesterwynde

Mit ihrem zehnten Album verteidigen Nightwish erneut ihren Status als Symphonic Metal-Pionierband und liefern zugleich das wohl vielfältigste Album seit Floor Jansens Einstieg. Da „Yesterwynde“ aber auch das erste Album seit einer gefühlten Ewigkeit ist, das ohne Bassist und Charakterstimme Marko Hietala auskommt, war manch kritischer Gedanke im Vorfeld nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber Mastermind Tuomas Holopainen, wäre nicht er selbst, wenn er nicht erneut ein ambitioniertes Bombast-Werk zwischen musikalischem Größenwahn und kompositorischem Genie abliefern würde. Größter Pluspunkt diesmal: Orchester und Stromgitarrenmusik agieren wieder als eine untrennbare Einheit und Floor Jansen brilliert in ihrer Rolle als Frontsängerin noch mehr als zuvor. Das liegt nicht zuletzt auch an den mitreißenden Kompositionen, die vom Kinderchor meets Orchester Overkill „The Day of…“, über folkloristische Balladen wie „Sway“, bis hin zum fast progressiv strukturierten Bombast-Drama „Something Whispered Follow Me“ die volle Bandbreite des Soundspektrums, das von Nightwish bekannt ist, abdecken. Mit dem treibenden, an einen Filmsoundtrack gemahnenden „An Ocean of Strange Islands“ werden außerdem Erinnerungen an „Imaginaerum“ wach, wobei ebendieses Album in Sachen Vielseitigkeit und Dynamik durchaus Pate für „Yesterwynde gestanden haben könnte. Überraschungen gibt’s aber auch: „Sway“ begeistert als zarte Akustikballade mit Folk-Schlagseite, bei der sich die Stimmen von Floor Jansen und Troy Donokley hervorragend ergänzen, ehe das Bombast-Spektakel „The Weave“ einmal mehr den fantastischen Sound des Albums unterstreicht. Hier werden Heavy Metal, Opern-Bombast und dramatischer Gesang nahezu perfekt verzahnt, ohne dass ein Element zu kurz kommt. „Lanternight“ beschließt „Yesterwynde“ dann mit zarten Klängen und intensiv-balladesker Stimmung bei der Floor Jansens Stimme den Löwenanteil am abschließenden, wohligen Schauer trägt.
Fazit: „Yesterwynde“ ist wohl das bisher vielfältigste Nightwish Album mit Floor Jansen als Frontfrau. Dass die Musik dementsprechend einige Zeit in Anspruch nimmt um zu zünden und zur vollen Größe heranzuwachsen, verwundert kaum. Dass Nightwish aber immer noch sämtliche Konkurrenz in Sachen opulent inszeniertem Symphonik-Drama-Metall in die zweite Reihe verweisen, ist ein Umstand der nach wie vor Anerkennung verdient.
18. Wintersun – Time II
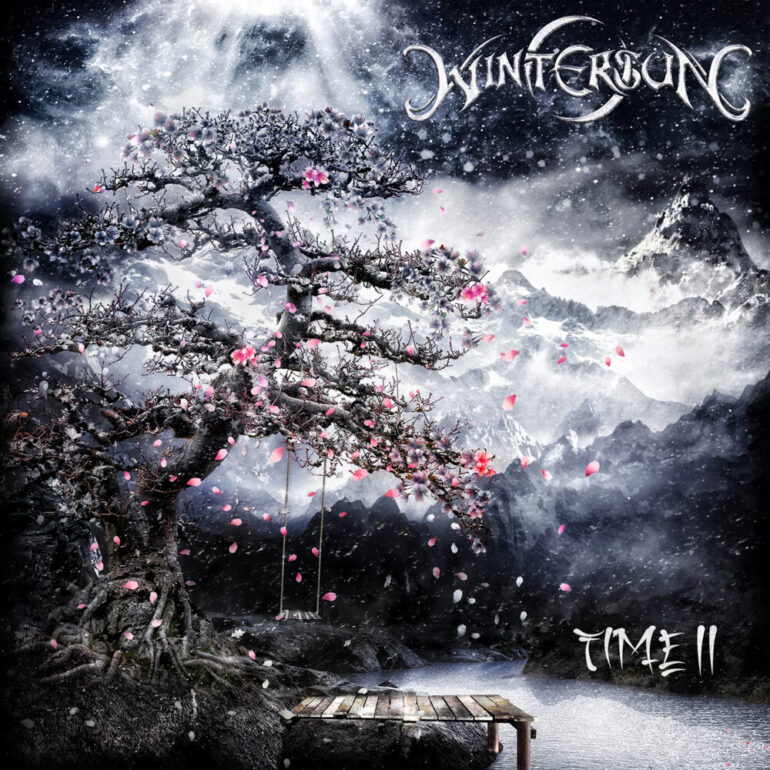
Nach zwölf Jahren Reifezeit, diversen Verschiebungen der Veröffentlichung und anderen nervenzerrenden Ankündigungen nimmt Wintersuns „Time II“ Ende August 2024 endlich Gestalt an. Dabei geht das Album in seiner Gestaltung und seiner Dramaturgie ähnliche Wege wie „Time I“, tönt aber tatsächlich differenzierter und erschlägt den Hörer anfangs mit einer wahren Soundwand. Das asiatische Thema, welches die beiden Teile auszeichnet wird erstmals in „Fields of Snow“, einer vierminütigen Ruhe vor dem Sturm präsentiert, der in Form von „The Way of the Fire“ erstmal gehörig erschlägt. Hier zeigen Wintersun all ihre Stärken, verspielte Melodien, temporeiches Songwriting zwischen Symphonik-Wahnsinn und metallischen Riffs und auch Jari Mäenpaas Gesang transportiert genau das richtige Gefühl zwischen Drama, Epik und Aggression. „One with the Shadows“ nimmt danach erstmal den Druck raus, geht gedrosselter ans Werk und glänzt mit komplexen Orchester-Arrangements, die den Hörer aber nicht erschlagen, sondern den Song wirklich bis zum Ende hin wie auf einer stetig ansteigenden Welle tragen, ehe „Ominous Clouds“ als verspieltes Gitarrenintermezzo Regen verkündet, der mit „Storm“ auch prompt folgt. Tatsächlich schaffen es Wintersun hier hervorragend den Titel angemessen in Musik umzusetzen. Der Song geht schnell zu Werke, bietet allerlei Wendungen und kleine Details in Sachen Melodie und Orchestrierung und erschlägt anfangs beinahe. Die Stimmung springt zwischen Drama, Aggression und Rauschzustand hin und her und wird von eingestreuten Gewitter-Samples zusätzlich verstärkt, ehe der Refrain immer dramatischer ansteigt und schließlich in einem ruhigen, fast andächtigen Finale (wieder mit asiatischen Soundmotiven) ausläuft. „Silver Leaves“ knüpft an das fernöstliche Flair an, zeigt Wintersun aber eher von der schleppenden, dramatischen Seite. Der Fokus liegt u.a. auf den dichten Gesangsarrangements und die Gitarren gehen warm und kaum aggressiv zu Werke. Hinzu kommen Folk-taugliche Melodien und Flöten-Kitsch, was einen gewissen Fantasy-Charakter erzeugt und am Ende in Glockenspielsounds und Windrauschen abklingt.
Fazit: Ob „Time II“ nun wirklich Wintersuns Opus Magnum ist, darf angesichts des musikalischen Größenwahns von Jari Mäenpää bezweifelt werden. In Anbetracht der der Erwartungshaltung, die im Vorfeld der Veröffentlichung geschürt wurde, kann „Time II“ im Grunde auch nur verlieren. Dass Wintersun hier aber eine Blaupause für detailverliebtes Ohrenkino geschaffen haben, steht außer Frage.
19. Bruce Dickinson – The Mandrake Project

Hat ja ‘nur‘ neunzehn Jahre gedauert bis Bruce Dickinson mit einer neuen Solo-Platte vorstellig wird. Dafür aber weiß der Mann wie man eine solche anpackt. Ob eine Comic-Reihe zusätzlich zu „The Mandrake Project“ zu viel des Guten ist, steht dabei eigentlich kaum zur Debatte, denn erstens, ist der erste Teil dieser Bildergeschichte wirklich gelungen (enthalten in der Mediabook-Version des Albums) und zweitens, überzeugt die Musik zu genüge. Dabei fällt „The Mandrake Project“ erstaunlich vielfältig aus. „Afterglow of Ragnarok“ drängt düster und energisch aus den Boxen, wartet aber mit einem hymnischen Refrain auf, der Mr. Dickinsons Sangesfreude auf diesem Album bereits erahnen lässt. „Many Doors To Hell“ knüpft an diese Freude an, wirkt aber schnörkelloser und geht als Paradebeispiel für eine Live-Hymne (inklusive fett groovender Orgel) durch. Der stampfende Rocker „Rain On The Graves“ gefällt mit augenzwinkernden Referenzen an Edgar Allan Poe und einem theatralischen Element, das den Gesang fast wie in einer Theater-Inszenierung erscheinen lässt. Mit Americana-Anleihen und dunklem Riffing geht „Resurrection Man“ im Anschluss noch dramatischere Wege, was Bruce Dickinson zu einer stimmlichen Glanzleistung beflügelt. Von schaurigen Höhen bis zu warmen Mitten, zieht der Herr sämtliche Register. „Fingers in the Wound“ schwingt sich als Mini-Epos zwischen orchestralem Bombast und orientalischem Flair zu einem echten Highlight auf, bevor „Eternity Has Failed“ auf eine Idee von 2015 zurückgeht und somit kein bloßes Abkupfern von Iron Maidens „The Book of Souls“-Opener ist. Vielmehr klingt diese Solo-Version von Bruce um Längen dramatischer und tönt auch organischer aus den Boxen. Das von hartem Groove angetriebene „Mistress Of Mercy“ erscheint anfangs gewöhnungsbedürftig, wächst im Refrain aber zur vollen Größe heran, ehe die akustisch geprägte Ballade „Face in the Mirror“ Pianosounds und getragene Grooves neben dunkler Saitenarbeit zu einer andächtigen Wohltat vereint. Gerade diese bedachten Nummern stehen Bruce Dickinson ausgezeichnet zu Gesicht, wie er auch im bombastischen „Shadow of the Gods“ (Queen-Dramatik trifft auf treibende Rhythmik und bissige Shouts) unter Beweis stellt. „Sonata (Immortal Beloved)“ beschließt „The Mandrake Project“ als ausladende Mini-Oper bei der Bruce Dickinsons emotional spannende Stimm-Mitten voll zur Geltung kommen, ehe die zweite Songhälfte psychedelische Gefilde betritt und einige Akzente in Sachen Gitarrenarbeit bereithält.
Fazit: Mit „The Mandrake Project“ zeigt sich Bruce Dickinson voll im kreativen Saft und präsentiert ein stimmungsvolles Album, das mitunter Zeit in Anspruch nimmt um seine Detailfülle und dramaturgische Klasse voll zur Schau zu stellen. Diese Einarbeitungszeit seitens des Hörers lohnt sich aber, denn die Spannbreite der Musik sorgt in jedem Fall für Kurzweil.
20. Ghøstkid – Hollywood Suicide
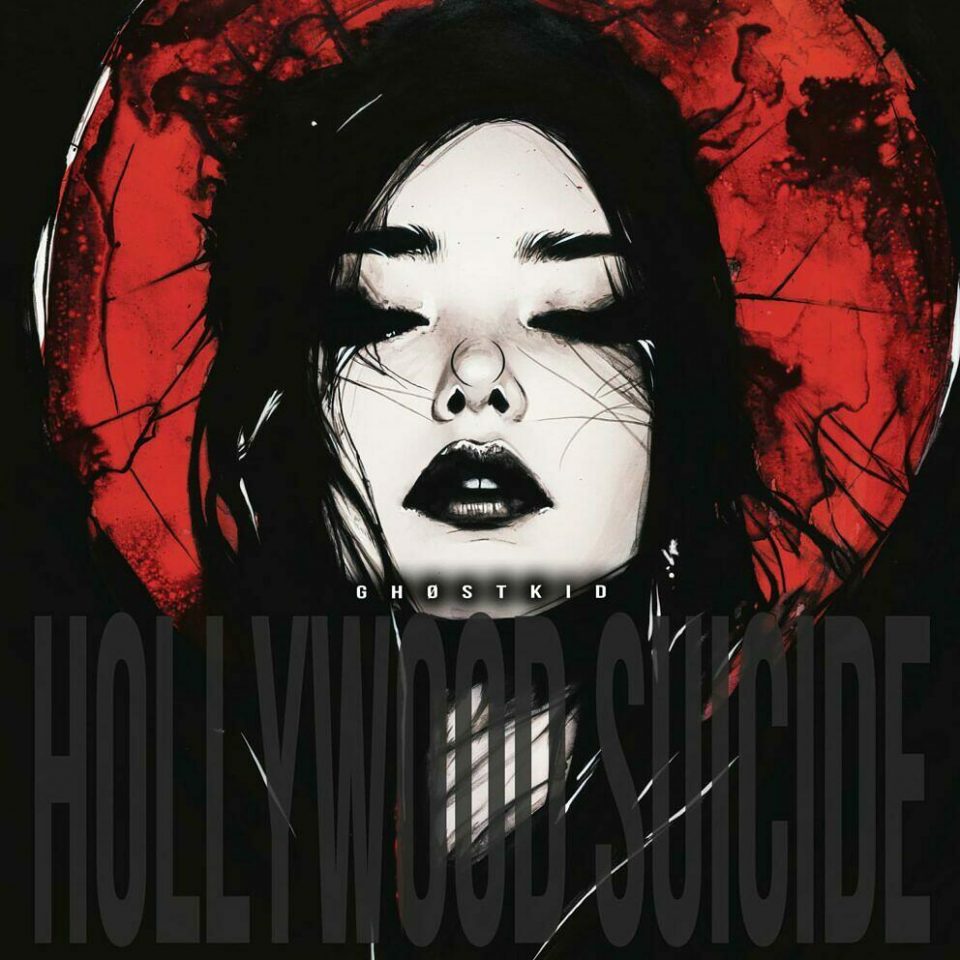
Eine wesentliche Veränderung zum Ghøstkid-Debüt vor vier Jahren besteht in der Stimmung von „Hollywood Suicide“, das sich düster, morbide und mitunter bedrückend aggressiv gibt. Dafür verantwortlich sind u.a. diverse Synth-Akzente, die in Stücken wie „Valerie“ oder „Heavy Rain“ für drängende Eingängigkeit zwischen Pop-Refrain und unterschwelligem Schmerz sorgen. Und obwohl die Elemente des Bandsounds spätestens seit dem selbstbetitelten Debüt bekannt sind, gewinnt „Hollywood Suicide“ durch seine mitreißende Eigenständigkeit. Das liegt, nicht zuletzt, am variablen Stimmeinsatz von Sebastian „Sushi“ Biesler, der zwischen emotional gebrechlichem Klargesang (z.B. in „S3X“) und garstig-aggressivem Geschrei einen hohen Wiedererkennungswert besitzt (nachzuhören u.a. im hyperaktiven „Black Cloud“). „FSU“ oder auch der Titeltrack geben sich stampfendem Electro-Core mit harten Riffs hin, öffnen sich in den jeweiligen Refrains aber in Richtung Eingängigkeit, die über die gesamte Albumlänge für gehöriges Mitsing-Potenzial sorgt. Das InHuman-Feature „Murder“ kommt als aggressiver Dubstep/Metalcore-Hybrid daher und erzeugt, trotz eingängiger Melodien, eine fast feindselige Stimmung, die sich in den beiden Schlusstracks „Dahlia“ und „Helena Drive“ in Richtung depressiver Trauer öffnet, ohne die Ohrwurmtauglichkeit außen vor zu lassen. Kurzum: Reinhören!
Dominik Maier