Dieses Jahr gab es wieder derart viele Top-Alben, dass die Vorauswahl ziemlich schwierig war. Diese Liste könnte also locker doppelt so lang sein und das Niveau der Musik wäre dennoch gleichbleibend hoch, doch das wäre zuviel des Guten. Die Sortierung ist lediglich dem Umstand geschuldet dass eine solche Liste irgendwo anfangen und enden muss. Musikalisch denke ich ist jede hier erwähnte Scheibe auf ihre Art einzigartig und einzigartig gut.
1. Our Survival Depends On Us – Melting the Ice in the Hearts of Men

Mit “Melting the Ice in the Hearts of Men” hat das Künstlerkollektiv Our Survival Depends On Us ein durchdachtes und tief emotionales Kunstwerk geschaffen. Der Sound kann als eine Melange aus Doom Metal mit progressiven Strukturen, einer mystischen Aura und unverkennbarer musikalischer Klasse beschrieben werden. So verwundert es nicht dass im Opener „Galahad“ Primordials Alan Averill für ein Gänsehaut-Duett mit von der Partie ist. Doch dieses Gimmick ist nur ein Sahnehäubchen denn OSDOU brauchen eigentlich keine Unterstützung um den Hörer mit auf ihre Achterbahnfahrt der Gefühle zu nehmen. Die Musik driftet zuweilen in meditative Sphären ab, ohne zerfahren zu wirken. Hier klingt jedes Instrument, jede Melodie und jede Gesangslinie exakt auf den Punkt komponiert und doch versprüht das Album eine gewisse Spontanität die zuweilen fast in Leichtigkeit übergeht. Doch bevor es soweit kommt, klingt der Gesang besonders am Ende des Openers beinahe wehklagend und das monolithische „Gold and Silver“ dröhnt erstmal massiv. Der Fokus liegt zunächst auf den walzenden Riffs. Nach knapp vier Minuten folgen ein eindringliches Bassmotiv und pulsierender Rhythmus. Passend dazu steigert sich auch der Gesang der ruhig beginnt und sich dann zusammen mit einer dröhnenden Soundwand immer mehr in anklagende Verzweiflung hineinsteigert ehe nach einem letzten klagenden Schrei eine ruhige Melodie das Stück ausklingen lässt. „Song of the Lower Classes“ ist ein eindrucksvolles politisch-soziales Statement das zunächst als finsterster Doom aus den Boxen dröhnt. Die Tiefen des Sounds verleihen dem Text, der u.a. Zitate des Arbeiterrechtsaktivisten Ernest Charles Jones aus dem 19. Jahrhundert enthält eine anklagende Dringlichkeit die bedrückend und beeindruckend zugleich ist. Die textliche Erkentnis dass der Mensch ein Sklave seines eigenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systems ist wiegt dabei umso schwerer dank der Einsicht, dass Geld leider nicht bloß Mittel zum Zweck ist. Vor diesem Hintergrund ist „Sky Burial“ eine düstere Katharsis. Mantrische Trommeln und hypnotische Soundscapes bilden das Konstrukt für den beschwörenden Schlussgesang. Das letzte Drittel des Songs klingt nochmal wie ein rebellisches Aufbäumen. Rhythmische Drums und fast post-rockiges Riffing beenden die Reise doch etwas versöhnlicher und lassen ein intensives, zutiefst menschliches Kunstwerk, das doch wie von einer anderen Welt wirkt sphärisch ausklingen. Intensiv, packend, überwältigend anders lässt sich dieses Album nicht zusammenfassen.
2. Avatarium –The Fire I Long For

Können Avatarium auch nach dem Ausstieg von Bandgründer Leif Edling überzeugen? Jeglicher Zweifel wird direkt mit dem Opener „Voices“ niedergebügelt. Das ist düstere Schneckenmusik in Reinform. Dazu kommt die bestechende Performance von Sängerin Jennie-Ann Smith die dem langsam kriechenden Song die Krone aufsetzt. Was für ein Auftakt! „Rubicon“ ist fantastisch. Die Musik lebt von einem leichten Gospel-Einfluss, die doomigen Elemente rücken ein wenig in den Hintergrund und machen Platz für schmeichelnde Melodien die sich ins Langzeitgedächtnis brennen und über allem thront der hymnenhafte Gesang der Fronterin. Der veredelt auch das melancholische „Lay Me Down“. Der Western-Flair verleiht dem Song etwas Tieftrauriges und sorgt dafür dass die Musik direkt unter die Haut geht. Gänsehautgarantie! „Porcelain Skull“ ist die erste von zwei Kompositionen aus der Feder von Bandgründer Leif Edling und zeigt zusammen mit „Epitaph of Heroes“ (der zweiten Edling Komposition) ein gewisses Dilemma. Der Mann ist ein guter Songwriter und verkörpert epischen Doom Metal in Reinform, doch im Kontext des Albums hat er einfach die schwächeren Songs. Denn ein Stück wie das lockere „Shake that Demon“ spielt beide Nummern an die Wand. Hier paaren sich Black Sabbath-mäßige Düsternis und Up-Tempo Rock n‘ Roll zu einer tanzbaren Nummer mit großartigem Gesang. „Great Beyond“ steckt dann wieder tief im Doom Metal. Schwermütige Riffs werden von Jennie- Anns Stimme zu einer dunkel glänzenden Perle veredelt. Das Titelstück ist ein weiteres Highlight. Vertäumte Melodik und getragene Rhythmen bauen sich langsam auf, fallen in der Bridge zusammen und gipfeln in einem herrlich melancholischen Refrain. Dem setzt der Gesang schließlich eine hell strahlende Krone auf. Die andächtige Abschlussnumer „Stars They Move“ sorgt dann nochmal für zentimeterdicke Gänsehaut. Lediglich von einem Piano begleitet liefert die Frontdame eine andächtige und zugleich herzzerreißende Finalperformance die das Album perfekt abschließt.
Fazit:
„The Fire I Long For“ ist ein Album von poetischer Schönheit das Licht und Dunkelheit gleichermaßen intensiv verkörpert und Avatariums Essenz auf den Punkt bringt.
3. Borknagar – True North

„True North“ markiert einen Umbruch in der Karriere Borknagars. Sind ihnen doch im Vorfeld einige Mitglieder abhanden gekommen, u.a. ihr zweiter Sänger Vintersorg. Kann die Band also ihre musikalische Klasse halten? „Thunderous“ liefert direkt die Antwort: Ja, sie kann. Hier werden cineastische Klangwelten und rasender Black Metal vereint. Auch die Progressivität kommt nicht zu kurz, man lausche nur mal den Bassmotiven die mit einem klasse Refrain verbunden werden. „Up North“ beginnt rockig und entwickelt sich zu einem progressiven Stück das zuweilen fast poppige Momente aufkommen lässt. So schmeichelt der Gesang besonders eingängig und wartet mit waghalsigen Harmonien auf die sofort im Kopf bleiben. „The Fire that Burns“ verbindet Aggression mit ausladender Epik. Sind die Strophen klar schwarzmetallisch zu verorten lebt der Refrain von dramatischem Klargesang. Das Stück schlägt aber einige Haken so dass man es keinem Genre klar zuordnen kann und genau das macht Borknagar schließlich aus. Ähnlich verhält es sich mit „Lights“ das leicht und verspielt beginnt und im weiteren Verlauf mit catchy Gesang aufwartet der im Kontrast zu den klirrenden Schreien der Bridge steht. „Wild Father’s Heart“ markiert dann das Herzstück des Albums. Der Song steigert sich mit jeder Strophe weiter ohne in wirkliche Extreme auszubrechen. Genau das macht die Musik aber so spannend. Der Gesang erzeugt ein ums andere mal Gänsehaut die auch im folgenden „Mount Rapture“ anhält. Einem komplexen Konstrukt aus breitwandigem Rock und wütendem Black Metal mit proggigen Melodien. „Into the White“ hat was von einer Wanderung durch verschneihte Berge bei Nacht. Man weiß nie genau was hinter dem nächsten Gipfel wartet, kann aber den stetigen Anstieg der Reise spühren. Die Musik baut sich stetig auf, bietet Gitarrenmelodien en masse und wird immer wieder von progressiven Elementen aufgebrochen. Sporadische Schreie unterstützen den Klargesang der allerlei Bilder vor dem inneren Auge erzeugt. „Tidal“ ist einfach groß. Der ruhige Anfang geht in richtig heftige Strophen über und doch wirkt der Song stellenweise fast erhaben. Hier werden Black Metal Raserei, Progressive Rock und Ohrwurmmelodien zu einem stimmigen Ganzen verbunden. „Voices“ bildet den leuchtenden Schlusspunkt der Reise. Der Gesang steht klar im Vordergrund und der Song wirkt eher wie ein folkiges Mantra. Breitwandige Ausbrüche schieben die Stimme regelrecht vor sich her so dass das ruhige Finale fast versöhnlich wirkt.
Fazit:
„True North“ ist eine schillernde Reise durch die Möglichkeiten progressiver Musik und dank des hohen kompositorischen Niveaus eines der großen Alben des Jahres.
4. Gaahl’s Wyrd – GastiR – Ghosts Invited

Nachdem sich Gaahl eine zeitlang aus der Metalszene verabschiedet hatte ist dieses Jahr das Debut seines neusten Projekts Gaahl’s Wyrd erschienen. Erwartet man allerdings Black Metal im typisch rasanten Stil wie bei Gorgoroth oder folkloristische Sounds wie etwa bei Wardruna ist „GastiR – Ghosts Invited“ eine faustdicke Überraschung. Zwar bleibt Gaahl’s Kunst unverkennbar im Black Metal verwurzelt, doch gerade was den Gesang angeht experimentiert er ungewohnt viel. So überrascht die vertrackte Einstiegsraserei „Ek Erilar“ mit düsterem Flüstern und kalter Atmosphäre bevor „From the Spear“ mit thrashigen Riffs aufwartet. Dabei klingt Gaahl fast beschwörend und lässt von Flüstern über Klargesang bis zu kraftvollen Shouts alles vom Stapel. In „Ghosts Invited“ hämmern die Drums massiv auf die kalten Melodien ein ohne das Konstrukt zu zerschlagen. Der fast mantrische Klargesang scheint über der Musik zu schweben und verleiht dem Song eine Sogwirkung die sich in „Carving the Voices“ manifestiert. Die Drums sind mächtig, die Gitarren sorgen für einen meditativen Charakter und Gaahls Stimme verleiht der Musik eine kalte Bösartigkeit die sich nur schwer greifen lässt und vor allem durch die Rhythmuswechsel viele Facetten aufweist. Stark! „Veiztu Hve“ klingt wie der aggressive Gegenpart zum Vorgängersong. Das Tempo wird angezogen und gesanglich gibt’s wieder fiese Screams, allerdings überrascht der Song mit einigen kleinen Wendungen wie etwa dem Klargesang im Mittelteil der zusammen mit den geflüsterten Zeilen für Gänsehaut sorgt ehe der Song auf dem Höhepunkt plötzlich abbricht. Fantastisch! „The Speech and the Self“ zeugt einmal mehr vom ausgefallenen Wechselspiel von Gaahls variabler Stimme und den Gitarren. Dabei sorgt besonders die Rhythmik für Spannung was den Song zu einem echten Hit düsterer Musik macht. Danach schwingt „Through and Past and Past“ die Black Metal Keule. Die Riffs sind kalt aber vielschichtig und geben der Stimme zusammen mit dem rasanten Drumming ein krachendes, teilweise fast thrashiges Fundament. Der Rausschmeißer „Within the Voice of Existance“ reißt das Ruder dann nochmal komplett herum und schifft eher in zähen, hypnotischen Gewässern. Zunächst gibt es nur rhythmische Drums, fast wabernde Gitarren und beschwörendes Flüstern. Nach und nach tragen repititive Riffs und hämmernder Groove den mehrstimmigen Gesang bis zum Ende ehe der Song langsam ausklingt. „GastiR – Ghosts Invited“ ist ein stimmiges Stück Düstermusik mit dem Gaahl viele mutige Schritte wagt. Dass dabei ein solch fesselndes Album enstanden ist zeugt von der künstlerischen Größe seines Erschaffers.
5. Bölzer – Lese Majesty
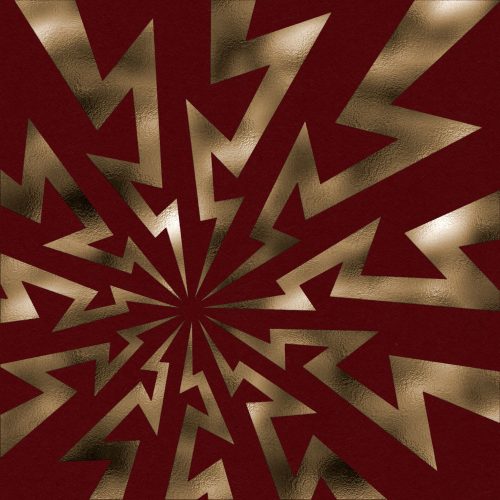
HzR und KzR melden sich mit einer neuen EP zurück und agieren auf „Lese Majesty“ eine ganze Ecke roher als auf „Hero“. Die romantischen Elemente des Debuts sind in den Hintergrund gerückt und geben den Ursprüngen des Bandsounds wieder mehr Raum. Dabei schaffen es die beiden Musiker nach wie vor ihren eigenen Mahlstrom zu kreieren der sich in keine gängigen Genreschubladen pressen lässt. Der Einstieg „A Shepherd in Wolven Skin“ knüppelt nach einem kurzen Intro sofort drauflos. Das Riffing wirkt wie eine Woge die immer wieder nach vorne prescht, sich zurückzieht und dann noch gewaltiger auf den Hörer niederschwappt. Ähnlich verhält es sich beim Gesang der den jeweiligen instrumentalen Part wahlweise mit proglamatischem Raunen oder mantrischem Klargesang auf die Spitze treibt und dem Song eine finstere Zerrissenheit verleiht. „Æstivation“ ist ein pulsierendes Ambient-Biest das in „Into the Temple of Spears“ übergeht. Es wird dunkel und rasant. Die Melodien klingen zerfahren und doch exakt vielschichtig komponiert und das Schlagzeug donnert fast durchgehend. Dabei wirken die Variationen von Groove und Tempo wie Ausbrüche aus den vorangegangen Parts. Der Gesang setzt dem Song die Krone auf. HzR zeigt seine komplette stimmliche Bandbreite von beschwörendem Klargesang über finstere Growls bis zu manischen Schreien und macht seine Stimme über die gesamte EP einmal mehr zu einem eigenständigen Instrument. So auch im finalen „Ave Fluvius! Danú Be Praised!“ das eine Brücke zur Dualität des Openers schlägt. Das Schlagzeug knüppelt heftig wird aber in einigen Nuancen immer wieder variiert und bildet eine spannende Basis für die akustischen Reise die HzR an der Gitarre und besonders im Gesang veranstaltet. Der Frontmann zieht alle Register und zeigt von aggressiven Screams über klagenden Gesang bis zu einnehmenden Growls alles was er zu bieten hat. Dazu kommt ein unterschwelliges Surren der Gitarre das sich aufbaut und im nächsten Moment wieder zurückzieht, was eine stetig ansteigende Bedrohlichkeit erzeugt. Das ruhige Outro wirkt erlösend und erdrückend zugleich und hinterlässt ein Gefühl von finsterer Anspannung. Ein fantastisch irrer Ritt von einer Band die nach wie vor eine Ausnahmestellung in der Musiklandschaft innehat.
6. Brutus –Nest

Brutus lassen sich auch mit ihrem Zweitling „Nest“ in keine Schublade pressen und präsentieren einen kompromisslosen Bastard aus rotzigem Hardcore mit Rock ’n Roll Kante, Post-Rock und punkiger Eigenständigkeit. Und doch trifft jedes der genannten Attribute nur bis zu einem gewissen Grad zu, denn die Musik ist vor allem eins: Unvergleichlich. Songs wie der Opener „Fire“ oder das knackige „Blind“ sind kurze Brecher mit punkigem Vibe wohingegen ein Song wie „Space“ vollkommen aus dem Rahmen fällt. Beinahe leichtfüssiger Groove, keine rasenden Ausbrüche, aber eine Hookline die sich hartnäckig ins Langzeitgedächtnis frisst. Der ganz große Coup gelingt der Band mit „Django“. Gesang und Riffing arbeiten regelrecht gegeneinander, klingen doch homogen und werden vom trocken knallenden Schlagzeug zusammengehalten. Die wahre Glanzleistung ist aber der Gesang der Drummerin. Sie klagt ohne weinerlich zu sein, schreit ohne zu brüllen und liefert eine der ergreifendsten Darbietungen der Bandgeschichte ab. Doch auch ihre beiden Mitmusker machen einen super Job, wovon besonders der Rausschmeißer „Sugar Dragon“ zeugt. Hier werden flächige Gitarren, die zuweilen an die Großmeister von Alcest erinnern mit fast zuckersüßem Gesang kombiniert. Dazu trommelt die Dame hinter der Schießbude mal bleischwer, mal mit ungestümem Galopp und liefert gesanglich so ziemlich alles ab was man von ihr kennt: Von klagenden Schreien bis zu ruhigem Klargesang ist alles dabei und geht direkt unter die Haut. Ähnlich verhält es sich mit dem direkten Vorgänger „Horde V“ der als ungestümes Hardcore Brett losballert und immer wieder mit schwarzmetallischem Riffing liebäugelt. Man könnte noch so viel über Brutus‘ Musik im Allgemeinen und „Nest“ im Speziellen schreiben und doch liegt jeder Versuch einer Beschreibung zur Hälfte daneben. Diese Band muss man einfach hören um sie zu begreifen. Das gefällt sicher nicht jedem und das will die Band wohl auch gar nicht erreichen, sticht sie doch mit ihrer unkonventionellen Vernetzung verschiedener Stile deutlich aus der Musikwelt hervor, aber genau das macht die Musik einzigartig und hörenswert.
7. Bombus – Vulture Culture

Jetzt pfeifen sie endgültig auf stilistische Greifbarkeit. „Vulture Culture“ wildert sowohl im rotzigen Rock n‘ Roll als auch im Punk. Dann schimmern knallende Momente a la Metallica durch, nur um mit einer Prise Sludge aufgepeppt zu werden. Und auch diese krude Stilbeschreibung greift zu kurz. Bombus haben sich mittlerweile ihre eigene musikalische Nische geschaffen und toben sich darin nach Herzenslust aus. „A Ladder – Not a Shovel“ fällt sofort mit der Tür ins Haus. Der Goove knallt, die Melodien gehen ins Ohr. Dann setzt der Gesang ein und die Band gibt Gas. Das ist Rock n‘ Roll pur. Zum Ende gibt’s einen kleinen Break ehe der Song beinahe ruhig und harmonisch ausklingt. „(You are all just) Human Beings“ tritt wieder aufs Gaspedal klingt aber noch melodischer. Die Riffs bleiben hängen und der Gesang macht den Song endgültig zum Ohrwurm. Ganz stark! „Mama“ stampft breitbeinig aus den Boxen. Nach der ersten Hälfte weicht der High Energy-Rock einem langsamen Groove dessen verspielte Melodik beinahe doomig klingt. Die nächste Überraschung heißt „It’s All Over“ und präsentiert sich als Ballade die immer wieder anschwillt und sich in großartigen Chören entlädt. Die Strophen werden von melodischen Gitarren getragen, dann gibt’s doch rotzigen Gesang der aber so emotional klingt dass man am Ende nur staunen kann. „In the Shadows“ klingt fast episch (für Bombus Verhältnisse) und rifft doch energisch drauflos. Ein herrlicher Ohrwurm mit dreckigem Groove. „We lost a lot of Blood today“ klingt wieder deutlich rauer, besonders im Gesang. Dazu gibt’s abgespeckten Groove der viel Raum für die Stimme lässt. Ein cooler Break teilt den Song in der Mitte und geht in ein Gitarrenmotiv über das zwar einfach klingt aber gerade deshalb super passt. Der Titeltrack glänzt mit zweiteiligen Strophen die von beiden Sängern als cooles (offensichtliches) Duett gestaltet werden. Der Refrain groovt fett und das furiose Ende rundet den Song ab. „Two Wolves and one Sheep“ lebt von allerlei kleinen Wendungen und liebevoll ausgearbeiteten Details. Der rotzige Gesang sorgt für den passenden Kontrast und geht schnell ins Ohr. „Feeling is Believing“ tritt dann nochmal richtig Arsch. Die Riffs schieben den Song kräftig an und der Gesang in den Strophen klingt rau und dreckig. Im Refrain gibt’s die nötige Portion Melodie und am Ende leiten eine fette Doublebass und zweistimmige Leads das Album zügig aus.
Fazit:
Mit „Vulture Culture“ präsentieren Bombus einige interessante Neuerungen in ihrem Sound, bleiben aber ihrem Rock n‘ Roll Kern treu. Das Album macht Spaß und hat sowohl Kopf als auch jede Menge Herzblut und das war schon immer die Hauptsache bei den Hummeln.
8. Cattle Decapitation – Death Atlas

Spätestens mit dem Vorgängeralbum sind Cattle Decapitation dem wüsten Grindcore-Gemetzel ihrer Anfangstage entwachsen. Statt offensichtlicher Brutalität setzten die Musiker vermehrt auf Atmosphäre was die Musik ein Stück weit zugänglicher machte. „Death Atlas“ markiert nun den bisherigen Höhepunkt dieser Entwicklung. Ohne ihre Trademarks zu vernachlässigen hat die Band ein atmosphärisch dichtes Werk geschaffen das trotzdem vor Brutalität strotzt. (Dass alle beteiligten Musiker dabei in ihrem Können über jeden Zweifel erhaben sind versteht sich wohl von selbst.) Getreu dem Albumtitel ist ihnen damit der perfekte Weltuntergangssoundtrack gelungen, dessen Texte eine augenscheinlich gar nicht mal unwahrscheinliche Apokalypse kreieren. Songs wie „Bring back the Plague“, der Opener „The Geocide“ oder „One Day Closer to the End of the World“ sprechen eine deutliche Sprache, sowohl textlich als auch musikalisch. Ein besonderes Element dabei ist der Gesang von Travis Ryan. Der Mann hat von finsteren Growls über Screams bis hin zu durch Mark und Bein gehendem (beinahe) Klargesang die komplette Parlette extremer Klänge drauf. Die enthaltenen Interludes teilen das Album in drei Teile. Verzerrte Stimmen prognostizieren diverse Endzeitbotschaften und schaffen eine bedrückende Stimmung die sich in den jeweils folgenden Songs entlädt. So auch in „Finish Them“ einem anfangs stampfenden Brecher, der sich auf einen brutalen Blastbeat hinsteigert und am Ende mit monströsen Growls und mörderischem Groove endet. Ein gutes Beispiel für die Dynamik des Albums ist „Time’s Cruel Curtain“. Nach einem opulent tönenden Intro bricht eine blastende Strophe los, steigert sich zu rasantem Dauerfeuer ehe der Refrain den Hörer mit langsamem Groove, eindringlicher Melodik und dem aggressiv-bedrückenden Gesang gefangen nimmt. Das letzte Interlude „The Unerasable Past“ steigert die triste Stimmung fast ins Unerträgliche, klingt dank des Pianos und des Klargesangs aber regelrecht schön. Diese Dualität entlädt sich im abschließenden Titeltrack der das Album in vollkommener Resignation beendet. In über neun Minuten prognostizieren die stimmlichen Kontraste zusammen mit Blasts, stampfenden Grooves und messerscharfem Riffing den Niedergang der Menschheit, ehe das schleppende Ende den Hörer geplättet zurücklässt. Die finalen Gesänge klingen hoffnungslos, fast verzweifelt und hallen bedrückend intensiv nach.
Fazit:
Musikalisch und spieltechnisch nach wie vor über jeden Zweifel erhaben liefern Cattle Decapitation mit „Death Atlas“ ihre bisher vielschichtigste und intensivste Platte ab mit der sie die Apokalypse beeindruckend nahbar vertonen. Starker Tobak, starkes Album!
9. Ashbringer – Absolution

„Absolution“ ist eine Traumreise durch die Extreme. Dabei schießt die Band bei der enormen Spielzeit von knapp siebzig Minuten glücklicherweise nicht über das Ziel hinaus sondern schafft es den Hörer bei der Stange zu halten respektive dahinträumen zu lassen. Das bestätigt sich schon beim akustischen Intro des Openers. Die einzige wirklich dunkle Konstante in der Musik ist das klagende Geschrei des Sängers. Ansonsten schaffen Ashbringer das Kunststück ihre Musik zwar in eine schwarzmetallische Ästhetik zu kleiden dabei aber immer großflächige instrumentale Soundteppiche zu weben die frei von allen Genregrenzen sind. Während die Musik detailverliebt ausgearbeitet ist und so ziemlich die komplette Bandbreite an möglichen Emotionen transportiert fungiert das harsche Schreien des Sängers als sehr guter Kontrast zur Musik und setzt immer wieder markante Akzente. So wirkt ein Song wie „Wilderness Walk“ nicht zuletzt aufgrund der Kombination von Screams und lieblichen Melodien so eindringlich und herzzerreißend. Doch einen bestimmten Song wirklich herauszugreifen ist schwierig da „Absolution“ am besten als Gesamtkunstwerk funktioniert bzw. zu begreifen ist. Hört man sich die Songs separat voneinander an klingen sie gut, doch erst wenn man das Album als Ganzes anhört und begreift strahlt die Musik. Die vielen Details können eh erst nach mehrmaligem Hören erfasst werden. So ist „Absolution“ ein starkes Album das den Hörer bewusst fordert, zugleich aber ein wirksames Ventil für die eigene Fantasie. Augen zu und losträumen. Sicher nichts für jeden aber wer ein offenes Ohr und ein offenes Herz für Musik hat und diese dem Album widmet, der wird mit einer Reise durch das nahezu komplette Farbspektrum emotionaler (Rock-) Musik belohnt.
10. Der Rote Milan – Moritat

Mit dem Schinderhannes haben sich Der Rote Milan einen Übeltäter des dreißigjährigen Krieges zur Brust genommen und basierend auf diesem doch breiten Textkonzept ein amtliches Black Metal Geschoss kreiert. Die Texte beschreiben sowohl die Taten des Schinderhannes als auch seinen Werdegang bzw. Niedergang bis zur Hinrichtung. „Die Habsucht“ eröffnet das Album mit fast meditativen Flötenklängen ehe heftige Raserei einsetzt. Die Drums ballern und die schneidenden Riffs werden immer wieder von ruhigen akustischen Parts abgelöst. Der Gesang untermahlt die jeweilige Stimmung des Songs mal als hauchiges Flüstern, mal als aggressives Geschrei. „Drohende Schatten“ ist ein manischer Trip und macht seinem Namen alle Ehre. Ein eisiger Sturm bricht los und wird vom dominanten Drumming vorangepeitscht. Die Stimme klingt mal giftig, mal hüllt das dunkle Geschrei die Musik regelrecht ein. Dass die Gitarren dabei zunächst eine eher untergeordnete Rolle spielen ist interessant und doch ist die Melodik unverzichtbar, verleiht sie dem Song doch die titelgebende Bedrohung. „Gnosis der Vergänglichkeit“ ist ein irrer Ritt der sich immer weiter aufbaut, in jedem Refrain kurz explodiert um sich dann wieder von neuem aufzuschichten. „Der letzte Galgen“ bleibt im Midtempo verhaftet, allerdings rattert das Schlagzeug in den Strophen präzise wie ein Maschinengewehr. Die Rezeptur ist ähnlich wie beim Vorgänger, doch in der Mitte klingt der Song beinahe entrückt was ihm eine morbidere Note verleiht. Was Besonderes sind dann noch die schamanischen Schlussgesänge die den Nachfolger „Der Findling“ einleiten. Der klingt ein wenig wie die Erlösung aus der entstandenen Qual der beiden Vorgänger. Besonders die Gitarrenmelodien sind ein Aufhänger an dem sich der morbide Gesang entlanghangelt. Zum Ende wird die Musik immer dunkler und baut so die Stimmung für den finalen Titeltrack auf. Der ist ein Ritt durchs Chaos. So steigert sich der Song bis zur Mitte hin, variiert den knallenden Groove mehrmals bevor die Gitarren nach einem akustischen Zwischenspiel der totalen Finsternis weichen. Die kommt sowohl im mehrstimmigen Geschrei als auch in den Riffs und Melodien zum tragen. Das letzte Drittel ist akustisches Sperrfeuer in dem klirrendes Gekeife die Gitarren konterkariert. Im Mittelteil kehrt die manische Stimmung des Openers zurück und mündet in extreme Raserei die das textliche Geständnis des Protagonisten bis zu seiner Exekution passend begleitet.
Fazit:
„Moritat“ sticht sowohl textlich als auch musikalisch aus dem Black Metal hervor. Zwar sind einige Ansätze und Variationen des Albums sicherlich Geschmacksache, doch die Musik zeugt von einem gewissen Weitblick der Band, ohne die gesteckten Grenzen des Genres zu verlassen oder zu verweichlichen. Ein spannendes Zweitwerk das neugierig auf die Zukunft macht.
11. Baest – Venenum

Zwei Jahre, zwei Alben. Baest legen ein hohes Tempo vor und knallen dem geneigten Hörer mit „Venenum“ ein ordentliches Brett vor den Latz. Der Opener „Vitriol Lament“ fällt auch sofort mit der Tür ins Haus. Hier gibt’s Highspeed Death Metal der einem die Rübe abschraubt. Die Growls klingen mächtig bösartig und der Groove plättet einfach alles! „Gula“ walzt dagegen tonnenschwer aus den Boxen. Die tiefe Stimme verleiht der Musik etwas Infernalisches das immer mächtiger wird. Bevor der imposante Titelsong das Tempo wieder anzieht ist „Nihil“ eine progressiv-finstere Machtdemonstration. Der Groove donnert überwiegend bleischwer, die Riffs sind aggressiv, glänzen aber immer wieder mit vertrakten Einschüben und Melodien und dazu diese Stimme…das finstere Gurgeln klingt gnadenlos bösartig ohne in unverständliches Blubbern abzudriften. Das akustische „Styx“ bildet dann eine schöne Überleitung zum infernalischen „Heresy“. Der Wechsel aus stampfenden Passagen und kontrollierter Raserei in den Strophen funktioniert gut und das Gitarrensolo am Ende ist ein cooler Kontrast zum finsteren Gebrüll. „As Above So Below“ huldigt danach mehr oder weniger unverblühmt Chuck Schuldiners Death. Die progressive Songstrukur, mitsamt rasanter Ausbrecher erinnert sehr an die Szenelegende, doch schaffen es Baest den Spirit frisch zu halten und das nötige Quäntchen eigene Identität in die Musik zu packen. Insofern kann der Song nur als gelungen bezeichnet werden. „Sodomize“ ist ein D-Zug. Die Doublebass donnert überwiegend in Hochgeschwindigkeit los. Dabei gibt’s immer wieder etwas progressivere Gitarrenarbeit die den ansonsten sehr massiven Song auflockern. Bevor das coole Bolt Thrower Cover „No Guts, No Glory“ das Album beschließt ist „Empty Throne“ nochmal eine Dampfwalze. Der Song groovt mörderisch und besonders in den schnelleren Strophen klingen Riffs und Gesang derart stark dass die filigraneren Einsprengsel zum Ende für eine coole Überraschung sorgen ehe der Refrain einfach alles vernichtet. Der Tod kann so schön sein!
12. Vukari – Aevum

“Aevum” ist ein pechschwarzer Strudel in dessen Sog sich aber viele verschiedene Schattierungen entdecken lassen. Der Einstieg „Abrasive Hallucinations (Reality Hemorrhaging)“ ist zunächst bedrückend und schwer. Bei aller Düsternis schwingt jedoch eine gewisse Schönheit in den vielschichtigen Gitarrenmelodien mit. „Agnosia“ wirkt sogar noch finsterer. Die Gitarren weben großflächige Riffteppiche die in den dunkelsten Farben schattiert sind und zugleich erhaben strahlen können. Der sinistre Gesang wirkt in diesem Kontext wie der Gegenpol der die Musik im Gleichgeweicht hält. „Entire Worlds Encased in Ice“ klingt zunächst direkter und härter. Die Riffs werden noch dunkler und die Stimme hüllt den Song in eine Art schwarzen Kokon. Neben der ausgeklügelten Melodik gräbt sich besonders das Organ des Sängers immer tiefer in den Kopf des Hörers und malt dort finsterste Bilder. „Curiosity and Obsession“ klingt nicht minder dunkel wirkt aber leichter, beinahe träumerisch. Die Melodien vermitteln sogar ein wenig Aufbruchstimmung. Die Stimme bleibt dagegen düster wodurch ein angenehmer Kontrast ensteht. „Voidwalker“ hat danach ein destruktives Element das sich kaum fassen lässt. Das variable Schlagzeug schafft viel Raum für die Gitarren. Der Gesang klingt noch dunkler, fungiert aber eher als zusätzliches Instrument um die vielschichtige Stimmung zu transportieren. „Disparity (The Great Works)“ lebt maßgeblich von der Polarität zweier Seiten. Während die erste mit zum Aggressivsten gehört was das Album zu bieten hat klingt die zweite fast versöhnlich. Zwar bleibt vor allem der Gesang neblig düster doch zum langsamen Groove kreieren die Gitarren wunderschöne Melodielinien die dem klagenden Schlussgesang eine fast rosige Stimmung entgegensetzen. „The true King is Death“ vernichtet diese aufkeimende Positivität aber sofort wieder. Der Song fesselt durch eine unterschwellige Aggressivität die im langsamen Groove mitschwingt. Dazu passt der Ausbruch in Blastbeats zur zweiten Hälfte sehr gut. Der Album-Closer „Vacating Existence (The Final Departure)“ ist dann gewissermaßen die Erlösung/Vernichtung aus der bzw. durch die bisherige Albumstimmung. Neben wunderschönen Melodien treiben rasante Grooves den Gesang vor sich her. In der zweiten Hälfte bekommen die Gitarren ein fast blumiges Element das die Aggressivität konterkariert und schließlich in ein sphärisches Outro mündet. Dunkle Kunst, fesselnd und intensiv!
13. Nailed to Obscurity – Black Frost

Mit „Black Frost” erklimmen Nailed to Obscurity endgültig die Spitze der Düster-Metalszene. Die Musik ist dunkel ohne komplett finster zu werden, melancholisch ohne kitschig zu sein und findet die richtige Balance aus harten Riffs und zarten Melodien. Der Gesang setzt dem Ganzen schließlich die Krone auf. Der eröffnende Titeltrack erzeugt vom ersten Ton an eine bedrückende Stimmung. Zum Rhythmus der Toms startet klarer Gesang und dann wird’s finster. Tiefe Growls werden im Refrain von stampfenden Drums vorangetrieben. Zwischendurch gibt’s melancholische Gitarreneinlagen die den Hörer mehr und mehr gefangen nehmen. „Tears of the Eyeless“ startet energisch, entwickelt sich aber spätestens mit den wunderbaren Strophen zu einem melancholischen Sog. Hier wirkt die Kombination von cleanen Gitarren mit Growls und Klargesang mit heftigen Riffs besonders stark. Diese Kontraste dienen als Fixpunkte des Songs der ein ständiges auf und ab der Emotionen ist. „The Aberrant Host“ strahlt mit düsterer Kraft. Dabei sind die vielen Details perfekt ausbalanciert und besonders der vielschichtige Gesang sorgt für Spannung. „Feardom“ klingt dann tatsächlich nach vertonter Paranoia. Gerade wenn man den ganz fetten Groove erwartet flacht der Song ab und mündet in flächige Gitarrenklänge, wenn es ruhig wird donnert immer noch das eindringliche Schlagzeug und über allem schwebt der abgehackte Gesang und schleicht sich in den Kopf des Hörers. Ein irrer Ritt! “Cipher” wirkt noch introvertierter als alles davor. Cineastische Riffs, energischer Groove und ein zähes Ende. Der Gesang kommt nur akzentuiert zum Einsatz, aber vor allem die klaren Momente erzeugen Gänsehaut. Der mehrstimmige Klargesang in „Resonance“ sorgt für ein leichtes Grusel-Flair. Dadurch wirkt der Song wie ein kleiner Ausbruch aus der Schwere, obwohl auch dieses Stück keine leichte Kost ist. Der Schlussgesang klingt sogar beinahe meditativ und ist somit zugleich Bindeglied und Kontrastpunkt zum Albumfinale, denn „Road to Perdition“ fasst alle markanten Elemente des Albums zusammen, klingt aber nochmal dunkler. Die doomigen Parts der Strophen bekommen durch facettenreiches Drumming und melancholische Gitarren eine beinahe qualvolle Note. Dazu wirkt die Stimme wie eine stetig verglimmende Fackel die einsam durch die vorherrschende Finsternis streift um sich letztlich in sich selbst zu verirren. So bietet „Black Frost“ von allem etwas: Musik für lebensfrohe Menschen, Musik für Suchende aber auch Musik für nachdenkliche Seelen und einsame Stunden.
14. Avantasia – Moonglow

Nach dem starken Vorgänger „Ghostlights” waren die Erwartungen an „Moonglow“ hoch, umso beeindruckender ist die Leichtigkeit und Treffsicherheit mit der Tobias Sammet und seine Begleitmannschaft aus alten Bekannten und einigen Neuzugängen wieder neue Maßstäbe setzen. „Ghost in the Moon“ ist ein Auftakt nach Maß. Die zehn Minuten der Mini-Rockoper vergehen wie nichts und die Musik erinnert in ihrer kompositorischen Raffinesse an Songs wie Meat Loafs „Bat Out of Hell“. Danach haut „Book of Shallows“ voll auf die Zwölf. Mit Hansi von Blind Guardian und Mille von Kreator feiern zwei Avantasia Neulinge ihren Bandeinstand. Der Song scheint jedem Sänger auf den Leib geschrieben denn neben powermetallischen Passagen überzeugt besonders Mille mit seinem Geschrei zu thrashigen Riffs. Aber auch Jorn Lande und Ronnie Atkins wissen zu begeistern. Highlight! Der Titeltrack ist musikalisches Breitwandkino mit Tobias Sammet und Candice Night als Hauptakteuren. Beide singen besonders in der Hook so zuckersüß dass der Song lange im Kopf bleibt. Folkige Gitarren leiten „The Raven Child“ ein, das eine weitere kompositorische Sternstunde darstellt. Auf das balladeske Intro folgt eine opulente Breitwandrocknummer die den Spagat zwischen hart und zart perfekt ausreizt. Und Sangesgößen wie Hansi Kürsch, Tobi und Jorn Lande sind eh über jeden Zweifel erhaben. Eine Nummer die immer weiter wächst. „Starlight“ bietet straighten Power Metal, zündet sofort und hat mit Ronnie Atkins eine weitere Top-Stimme zu bieten. Für die ganz dicke Gänsehaut sorgt danach Geoff Tate im balladesken „Invincible“. Der Song wird maßgeblich von einem zarten Piano und Steichern getragen zu denen auch Tobi klasse singt. „Alchemy“ entpuppt sich als düsterer Stampfer den die beiden Sänger mit viel Dramatik füllen und am Ende versöhnlich ausklingen lassen. „The Piper at the Gates of Dawn“ ist eine cineastische Power Metal-Oper bei der alle Beteiligten eine Top-Leistung abliefern und in wahrhaft andere Welten entführen. Magnums Bob Catley veredelt „Lavender“ mit seiner einzigartigen Stimme und auch der Chorus erinnert an die Melodic Rocker. Durch die stimmliche Beteiligung und das kompositorische Talent von Herrn Sammet klingt der Song aber angenehm eigenständig und bildet ein weiteres Highlight auf dieser mit Top-Nummern gespickten Platte. Im flotten „Requiem for a Dream“ brillieren Michael Kiske und Tobi im Duett. Allerdings bleibt die Komposition etwas unter dem hohen Niveau der restlichen Scheibe. Die Cover Nummer „Maniac“ ist gut gemacht sticht aber ein wenig aus dem übrigen Albumkonzept heraus. Der Bonustrack „Heart“ klingt dann wesentlich geradliniger als alles zuvor und rundet das Album angenehm ab. „Moonglow“ präsentiert Avantasia so abwechlungsreich wie selten zuvor und kann locker an seine Vorgänger anknüpfen, bleibt abzuwarten was die Zukunft bringt.
15. Slipknot – We Are Not Your Kind

Schon der Albumtitel ist ein Statement. Und tatsächlich klingt „We Are Not Your Kind“ verrückt wie man es von Slipknot erwartet und ist doch neu und ungewohnt. So überrascht „Unsainted“ mit dem Einsatz eines Chores im Refrain der den ansonsten knüppelnden Song auflockert. Danach nimmt „Birth of the Cruel“ das Tempo raus, drückt aber umso schwerer. „Nero Forte“ dagegen ist ein Monster das Groove, Aggression und hymnischen Gesang gleichermaßen unter einen Hut packt. Das vielseitige „Critical Darling“ hat ein etwas verstörendes Element das sich besonders in Coreys Klargesang zeigt. Dazu gibt’s treibenden Groove der in den Strophen richtig heftig wird. Mit „A Liar’s Funeral“ folgt eine psychotisch-finstere Halbballade deren stampfende Ausbrüche für einige Überraschungen sorgen. Starkes Teil! „Red Flag“ kracht danach wieder brachial! Zwar klingt der Song nicht so innovativ wie seine Vorgänger, macht aber Spaß und erinnert in seiner Aggression an frühere Großtaten. Nach dem Interlude „What’s Next“ ist „Spiders“ ein Horrortrip. Die Härte wird komplett rausgenommen, stattdessen spielen Slipknot mit einer irren Atmosphäre (besonders im Gesang) und fast jazzigem Songwriting. Super! „Orphan“ brummt anfangs beinahe doomig und bricht dann in rasantes Riffing mit donnernden Drums aus. Besonders geil ist hier Coreys Gesang. Er brüllt in den Strophen richtig heftig wodurch der fantastisch gesungene Refrain umso eindringlicher wirkt. Die wabernden Synthies von „My Pain“ gehen unter die Haut und zusammen mit dem tickenden Beat klingt Corey hier beinahe schizophren und (im positiven Sinn) unangenehm eindringlich. „Not long for this World“ startet als längeres Outro zu „My Pain“ bevor Slipknot nochmal ordentlich auffahren. Der Groove drückt und das meißt zurückhaltende Riffing glänzt in den richtigen Momenten mit ordentlich Power. Der Gesang kann als Weiterführung zum Vorgängersong durchgehen, denn die Intensität bleibt ähnlich hoch, bricht aber mehrmals in derbe Schreie aus. Das finale „Solway Firth“ zieht nochmal alle Register. Der Groove hämmert sich durch eine finstere Atmosphäre und Corey Taylor brüllt sich die Seele aus dem Leib. Die Melodien sorgen für eine Stimmung die den Hörer am Ende geplättet und bang zurücklässt. „We Are Not Your Kind“ beweist dass sich Slipknot immer noch kreativ weiterentwickeln wollen und können ohne ihre charakteristischen Elemente aus den Augen zu verlieren. Nach wir vor: Relevante Band.
Dominik Maier